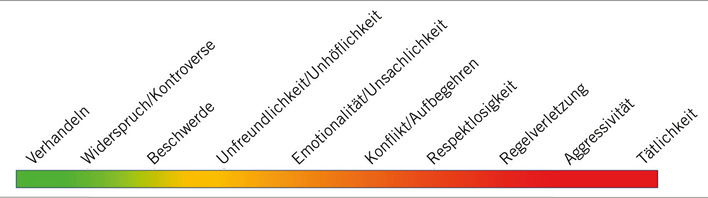Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
60 years of ASU – Occupational medicine in transition and facing new challenges
Since the first issue of ASU six decades ago, occupational medicine has continuously evolved. Today, we are facing a time of profound change: demographic shifts, climate change, technological innovations, and cost pressures in the healthcare system are placing new demands on occupational health services. What is the significance of occupational medicine for medical prevention, and how can the enormous preventive potential of the workplace be better utilized?
On the occasion of ASU’s 60th anniversary, we spoke with Silke Kretzschmar, Chairwoman of the Professional Association of Independent Occupational Physicians and Freelance Company Doctors (BsAfB), Susanne H. Liebe, President of the Association of German Company and Occupational Physicians (VDBW), Prof. Dr. Thomas Kraus, President of the German Society for Occupational Medicine and Environmental Medicine (DGAUM), and DDr. Karl Hochgatterer, President of the Austrian Society for Occupational Medicine (ÖGA). Among other things, we asked them about the key challenges and the positioning of occupational medicine and requested a statement on ASU as a professional publication.
60 Jahre ASU – Arbeitsmedizin im Wandel und vor neuen Herausforderungen
Seit der ersten Ausgabe der ASU vor sechs Jahrzehnten hat sich die Arbeitsmedizin kontinuierlich weiterentwickelt. Heute stehen wir vor einer Zeit tiefgreifender Veränderungen: Demografischer Wandel, klimatische Einflüsse, technologische Innovationen sowie der Kostendruck im Gesundheitssystem stellen neue Anforderungen an eine arbeitsmedizinische Betreuung. Welche Bedeutung hat die Arbeitsmedizin für die medizinische Prävention und wie lässt sich das enorme Präventionspotenzial des Arbeitsplatzes besser nutzen?
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der ASU haben wir mit Silke Kretzschmar, Vorstandsvorsitzende des Berufsverbands selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuflicher Betriebsärzte (BsAfB), Susanne H. Liebe, Präsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Prof. Dr. Thomas Kraus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM), sowie mit DDr. Karl Hochgatterer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin (ÖGA), gesprochen. Wir haben sie unter anderem nach den zentralen Herausforderungen und der Positionierung der Arbeitsmedizin gefragt und um ein Statement zur ASU als Fachpublikation gebeten.
Seit der ersten Ausgabe der ASU vor 60 Jahren hat sich in der Arbeitsmedizin viel getan. Heute wollen wir nach vorne blicken: Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen der Arbeitsmedizin für die Zukunft?
Susanne H. Liebe: Unsere Gesellschaft wandelt sich zusehends, beispielsweise steigt das durchschnittliche Alter der Erwerbstätigen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Berufstätige gesundheitliche Einschränkungen haben werden. Die Arbeitsmedizin wird sich künftig noch mehr mit der Frage beschäftigen müssen, wie die Erwerbsfähigkeit trotz gesundheitlicher Einschränkungen erhalten werden kann und man gut und gerne bis zum Renteneintritt arbeiten kann. Das bedeutet, dass Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sich auch vermehrt mit dem Umgang mit chronischen Krankheiten, wie Bluthochdruck oder Diabetes, bei der Arbeit beschäftigen müssen.
Thomas Kraus: Da kann ich der Kollegin nur zustimmen. Die Arbeitsmedizin beziehungsweise die Betriebsärztinnen und -ärzte müssen zunehmend ganzheitlich agieren und den gesamten Menschen und seine gesamte Lebenswelt zu betrachten. Das bedeutet, grundsätzlich immer auch Erkrankungen und Risikofaktoren außerhalb der Arbeitswelt einzubeziehen, die die Beschäftigungsfähigkeit sowie die Lebensqualität und Lebenserwartung gefährden können. Dazu zählen auch die klimatischen Veränderungen, wie zum Beispiel Hitzewellen.
Silke Kretzschmar: Klimatische Veränderungen betreffen besonders Menschen, die im Freien arbeiten oder schwere körperliche Arbeit verrichten. Ich betreue als Betriebsärztin viele Handwerksbetriebe, deren Beschäftigte mitunter schwere körperliche Tätigkeiten im Freien verrichten. Hier sind neue Arbeitsschutzkonzepte gefragt. Bei vielen kleinen Unternehmen ist bei der arbeitsmedizinischen Betreuung jedoch noch deutlich Luft nach oben, was sicher auch an mangelnden personellen Ressourcen liegt. Hier ist es wichtig, zum einen Aufklärungsarbeit zu leisten, zum anderen aber auch niederschwellige Angebote für die Betriebe einzurichten. Ich denke da zum Beispiel verstärkt an Online-Angebote in Form von Online-Sprechstunden, aber auch Fortbildungsmaßnahmen für die Unternehmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement.
Karl Hochgatterer: Neben den gesellschaftlichen und klimatischen Veränderungen erleben wir einen technologischen Wandel, der nicht nur die Arbeit selbst verändert – durch Automatisierung, digitale Vernetzung und mobile Tätigkeiten –, sondern auch unsere arbeitsmedizinische Praxis. Künftige Herausforderungen liegen darin, psychische Belastungen, Entgrenzung von Arbeit und neue Formen der Zusammenarbeit im Blick zu behalten und gleichzeitig digitale Technologien für Prävention und arbeitsmedizinische Versorgung sinnvoll zu nutzen.

Foto: AAMP
Das Gesundheitssystem in Deutschland steht unter Druck und der Ruf nach einer besseren Prävention wird gerade in letzter Zeit wieder deutlich hörbarer. Wie können die Arbeitsmedizin und die Betriebsärztinnen und -ärzte helfen?
Susanne H. Liebe: Die Arbeitswelt bietet ein enormes Präventionspotenzial. Nicht nur, weil wir hier rund 46 Millionen erwerbstätige Menschen in Deutschland erreichen, sondern weil gut und sicher gestaltete Arbeit einen wertvollen Beitrag zum individuellen Wohlbefinden leisten kann. In diesem Maßstab spielt die Arbeitsmedizin eine entscheidende Rolle für die Gesellschaft und dieses Potenzial schöpfen wir noch besser aus, zum Beispiel wenn wir die vorhandenen Möglichkeiten umfassender und zugleich passgenauer nutzen. Dies betrifft sowohl Primär- als auch Sekundär- und Tertiärprävention – von Impfungen über die Früherkennung von Erkrankungen wie Bluthochdruck bis zur Wiedereingliederung nach längerer Krankheit.
Silke Kretzschmar: Meine Erfahrung als Betriebsärztin zeigt mir, dass leider viele Menschen nicht die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Betriebsärztinnen und -ärzte erreichen Menschen, die sonst nicht zum Arzt gehen. Das Thema Impfen ist hier ein gutes Beispiel. Viele Erwachsene weisen Impflücken bei den Standardimpfungen auf, wie beispielsweise gegen Tetanus, Keuchhusten oder Polio. Meist ist das gar keine Absicht, sondern schlichtweg Vergesslichkeit. Wir Betriebsärztinnen und -ärzte können also einen wichtigen Beitrag leisten, gefährliche Impflücken zu schließen, indem wir Impfungen am Arbeitsplatz anbieten, auch wenn diese nicht direkt dem Arbeitsschutz dienen.
Thomas Kraus: Die Arbeitsmedizin muss als Teil des Gesundheitssystems begriffen werden. Das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz muss auch in der „Lebenswelt Arbeitsplatz“ Anwendung finden. Eine sektorverbindende beziehungsweise fächerübergreifende Versorgung trägt dazu bei, dass sich die medizinische Versorgung verbessert. Denn: Gesundheit lässt sich nicht in Berufs- und Privatleben unterteilen. So können gesundheitliche Risiken oft früher erkannt, Krankheiten frühzeitig behandelt und Doppeluntersuchungen vermieden werden. Davon profitieren Beschäftigte, Unternehmen und auch das Gesundheitssystem gleichermaßen.
Herr Hochgatterer, wie ist die Situation in Österreich? Wo können sich die beiden Länder ggf. gegenseitig etwas abschauen?
Karl Hochgatterer: Aktuell ist die österreichische Arbeitsmedizin durch die geltenden gesetzlichen Regelungen sehr fokussiert auf den klassischen Arbeitnehmer/-innen-Schutz. Allgemein präventivmedizinische Themen können ausschließlich außerhalb der vorgesehenen Präventivzeiten erbracht werden. Die ÖGA bemüht sich seit einigen Jahren in intensiven Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern des Arbeitsministeriums und den Sozialpartnern, insbesondere im Bereich des Impfwesens Änderungen herbeizuführen. In der ÖGA sind wir so wie bei Ihnen in Deutschland der Meinung, dass das Setting Arbeitsplatz ein enormes Potenzial für allgemeine präventivmedizinische Leistung hat. Der niederschwellige Zugang zu rund 4 Millionen Beschäftigten kann auf die Menschen und das Gesundheitssystem große positive Effekte haben.
Die drei deutschen Fachgesellschaften haben unlängst eine Kooperation unter dem Dach „die Arbeitsmedizin“ verkündet. Welche Ziele verfolgen Sie mit der Kooperation?
Silke Kretzschmar: Wir haben viele thematische Überschneidungen, die man besser bündeln kann, wenn es darum geht, uns bei den unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens, der Wirtschaft und der Politik Gehör zu verschaffen. Zusammen vertreten wir rund 6.000 Mitglieder, die letztlich alle eine optimale arbeitsmedizinische Betreuung der Bevölkerung anstreben. Hier sprechen wir mit einer Stimme und sind als Fach direkt adressierbar.
Thomas Kraus: Wir wollen die Sichtbarkeit der Arbeits- und Betriebsmedizin erhöhen und gleichzeitig die Bedeutung einer guten arbeitsmedizinischen Betreuung in Unternehmen aufzeigen. Denn der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ist nicht zuletzt auch ein wirtschaftlicher Faktor, der vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es handelt sich hierbei nicht um die Interessen einzelner Gruppen, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gleichzeitig ist der Erhalt der eigenen Gesundheit ein individuelles Anliegen jedes Einzelnen.
Susanne H. Liebe: Infolge des demografischen Wandels und in einer Zeit der Polykrisen erweist sich eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung als langfristiger und nachhaltiger Wettbewerbsvorteil. Eine gute arbeitsmedizinische Betreuung wirkt sich positiv auf die Beschäftigungsfähigkeit aus. Unternehmen können sich so als attraktive Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt positionieren und ihre Resilienz stärken. Genau das muss unsere Kooperation „Die Arbeitsmedizin“ gegenüber den Entscheidungsträgern im Gesundheitssystem, aber auch in Politik und Wirtschaft in aller Klarheit verdeutlichen.
Herr Hochgatterer, wie blicken Sie aus österreichischer Sicht auf die Kooperation? Wäre das auch ein Vorbild für Österreich oder könnte wäre auch eine Kooperation auf DACH oder gar auf europäischer Ebene denkbar?
Karl Hochgatterer: Im Vergleich zu anderen medizinischen Berufsgruppen ist die Zahl der in der Arbeitsmedizin engagierten Ärztinnen und Ärzte überschaubar. Für unsere Berufsgruppe ist es in dem schwierigen Feld der Wirtschaft enorm wichtig, geschlossen aufzutreten. In Österreich besteht zwischen den Ärztekammern (Länder und Bund), den Akademien und der ÖGA eine gute Abstimmung.

Foto: DGAUM/Scheere
Welche Rolle spielt die ASU als Fachpublikation bei der Verfolgung Ihrer Ziele und der Weiterentwicklung des Fachgebiets?
Thomas Kraus: Wir müssen auf allen Ebenen ein Bewusstsein für Veränderungen und die Rolle der modernen Arbeitsmedizin schaffen, auch im Bereich der Arbeits- und Betriebsmedizin selbst. Die ASU ist für unser Fachgebiet ein wichtiges Medium, hier erreichen wir vor allem die Akteurinnen und Akteure der Arbeits- und Betriebsmedizin.
Silke Kretzschmar: Ein guter Punkt der ASU ist, dass im Praxisteil auch Themen mit politischer Relevanz behandelt werden. Das bietet Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse zu teilen und zur Diskussion zu stellen. Die regelmäßige Leserin beziehungsweise der Leser kann sich so einen guten Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Fachgebiet verschaffen.
Susanne H. Liebe: Die ASU ist die ideale Plattform für einen Austausch innerhalb der Arbeitsmedizin. Wir publizieren regelmäßig Beiträge, mit denen wir wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Fachgebiets geben können. Über die ASU erreichen wir die Mitglieder der arbeitsmedizinischen Verbände, die dann wiederum unsere Botschaften weitertragen.
Karl Hochgatterer: Die ASU ist die Fachzeitschrift der DACH-Region und wird auch von Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedizinern in Österreich rege genutzt. Für uns eine perfekte Gelegenheit, sich länderübergreifend auszutauschen. Denn die Entwicklungen sind ja in beiden Ländern grundsätzlich sehr ähnlich. Auch wir wollen die Rolle der Arbeitsmedizin stärken und ein neues (Selbst-)Bewusstsein in unserem Fachgebiet schaffen.
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums noch eine persönliche Frage: Was verbinden Sie mit der ASU?
Susanne H. Liebe: Jeden Monat die ASU durchzublättern ist nicht nur ein liebgewonnenes Ritual, sondern es geht auch mit dem Gefühl einher, wieder ein bisschen mehr auf der Höhe der Zeit zu sein. Die Vielfalt der Themen und Beiträge lädt auch immer wieder zum Austausch innerhalb und außerhalb des Kollegiums ein.
Thomas Kraus: Mit der ASU verbinde ich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die über die letzten sechs Jahrzehnte gewachsen ist. Die ASU ist das offizielle Verbandsorgan der DGAUM. Die ASU bietet uns als wissenschaftlicher Fachgesellschaft außerdem die Möglichkeit, unsere gewonnenen Erkenntnisse der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen, so dass diese in der Praxis Anwendung finden können. Wünschenswert wäre, wenn die Fachzeitschrift schnellstmöglich einen Impact Faktor zugeteilt bekäme und integraler Bestandteil einer DGAUM-Mitgliedschaft werden würde.
Silke Kretzschmar: Wissenschaft und Praxis ergänzen sich gegenseitig, was das Fachgebiet insgesamt nach vorne bringt. Ich nutze gerne das Online-Archiv.
Karl Hochgatterer: Wir sind in Österreich glücklich darüber, dass die ASU sich als Ziel den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in der Arbeitsmedizin gesetzt hat. Diese Breite ist gerade für die österreichische Arbeitsmedizin von enormer Bedeutung. Wir schätzen die wertschätzende Zusammenarbeit und bedanken uns bei den Verantwortlichen für die Erbringung dieser Leistung über mittlerweile sechs Jahrzehnte!
Herzlichen Dank für das informative Gespräch!

Foto: privat