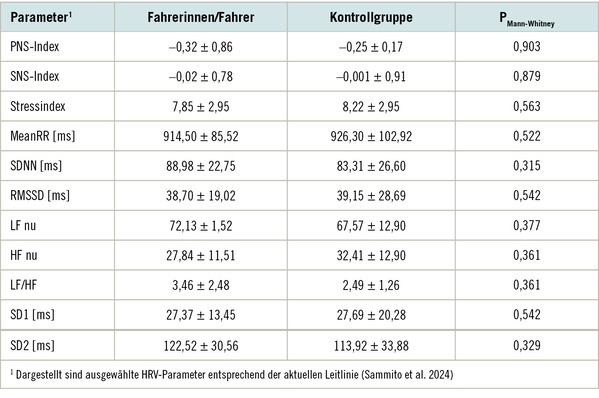Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
Occupational diseases in urology
Occupational diseases also affect urology, with the most common being tumors of the urinary tract caused by aromatic amines (occupational disease no. 1301) or polycyclic aromatic hydrocarbons (occupational disease
no. 1321), renal cell carcinomas after exposure to trichloroethylene (occupational disease no. 1302), and mesotheliomas of the tunica vaginalis testis after asbestos exposure (occupational disease no. 4105). These tumors can be recognized and compensated as occupational diseases if there is sufficient occupational exposure.
Berufskrankheiten in der Urologie
Berufskrankheiten (BK) betreffen auch die Urologie, wobei am häufigsten Tumoren der ableitenden Harnwege durch aromatische Amine (BK 1301) oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (BK 1321), Nierenzellkarzinome nach Exposition gegen Trichlorethylen (BK 1302) und Mesotheliome der Tunica vaginalis testis nach Asbestexposition (BK 4105) auftreten. Diese Tumoren können bei entsprechender, ausreichend hoher beruflicher Exposition als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt werden.
Kernaussagen
Einleitung
Berufsbedingte Erkrankungen betreffen auch das Fachgebiet der Urologie, wobei am häufigsten Tumoren der ableitenden Harnwege durch krebserzeugende aromatische Amine (BK 1301) oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (BK 1321) auftreten. Deutlich seltener sind Nierenzellkarzinome nach hoher Exposition gegen das Lösungsmittel Trichlorethylen (BK 1302) und Mesotheliome der Tunica vaginalis des Hodens nach Asbestexposition (BK 4105) zu beobachten. Anerkennungen nach Arsenexposition (BK 1108) und ionisierenden Strahlen (BK 2402) sind bisher eine Rarität. Diese Tumoren können nur dann als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt werden, wenn eine entsprechende, ausreichend hohe berufliche Exposition vorlag. Dabei liegen diese Expositionen in der Regel mehrere Jahrzehnte zurück. Im Rahmen der Zusammenhangsbegutachtung müssen berufliche und konkurrierende außerberufliche, also versicherte und nicht versicherte, Einwirkungen bewertet werden. Hier ist insbesondere das Rauchen als wichtigster außerberuflicher Risikofaktor für Tumoren der ableitenden Harnwege (BK 1301 und 1321) zu berücksichtigen.
BK 1301
Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der ableitenden Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase und Harnröhre) durch aromatische Amine können bei entsprechender beruflicher Exposition als BK Nr. 1301 anerkannt und entschädigt werden (BMA 1963; BMAS 2011a, 2016b). In der Regel handelt es sich dabei um Harnblasenkarzinome oder Tumoren des Nierenbeckens, der Harnleiter oder der proximalen Harnröhre. Aber auch gutartige Veränderungen der ableitenden Harnwege, wie zum Beispiel die abakterielle, chronische Urozystitis (Golka u. Schöps 2021), können durch aromatische Amine beziehungsweise polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe verursacht werden. Sie können gegebenenfalls Frühsymptome der Krebsentwicklung sein. Im Jahr 2024 wurden bei den Berufsgenossenschaften 1826 Anzeigen bei Verdacht auf BK 1301 gestellt, in 85 Fällen wurden Berufskrankheiten der Nr. 1301 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung anerkannt (DGUV 2024, siehe Online-Quellen). Aufgrund der langen Latenzzeit zwischen dem Expositionsbeginn gegenüber kanzerogenen aromatischen Aminen und der Erkrankung an Tumoren der ableitenden Harnwege in der Größenordnung von Jahrzehnten, ist die Erhebung einer vollständigen Berufsanamnese seit Beginn der Berufstätigkeit notwendig. Hierzu kann zum Beispiel der UROTOP-Fragebogen verwendet werden (Golka et al. 2019). Ausführliche Beschreibungen von möglichen Expositionsszenarien gegenüber kanzerogenen aromatischen Aminen in verschiedenen Berufen finden sich im BK-Report „Aromatische Amine“ in der jeweils aktualisierten Fassung (DGUV 2019, siehe Online-Quellen).
Für die Zusammenhangsbegutachtung bei Verdacht auf BK 1301 wurde für erfahrene arbeitsmedizinische Sachverständige die sogenannte BK 1301-Matrix entwickelt, die die berufliche Exposition sowie außerberufliche Risikofaktoren wie das Rauchen bewertet und es ermöglicht, den Zusammenhang zwischen der Einwirkung krebserzeugender aromatischer Amine und einer aufgetretenen Harnblasenkrebserkrankung auch dann arbeitsmedizinisch zu beurteilen, wenn eine konkrete kumulative Expositionsdosis aufgrund fehlender valider Expositionsdaten nicht angegeben werden konnte (Weistenhöfer et al. 2022). Derzeit werden auch Begutachtungsempfehlungen zur BK 1301 und 1321 erarbeitet, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 zur Verfügung stehen werden.
BK 1321
Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe können bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 80 Benzo[a]pyren-Jahren [(μg/m3) × Jahre] als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt werden (BMAS 2016a). Von der Substanzklasse der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK), die mehrere hundert Einzelverbindungen umfasst, wird das kanzerogene Benzo[a]pyren als Leitsubstanz für die Beurteilung von Berufskrankheiten verwendet, da es analytisch gut bestimmt werden kann und der Metabolismus des Benzo[a]pyrens am intensivsten erforscht ist. Tumoren der ableitenden Harnwege durch PAK (BK 1321) treten deutlich seltener als diejenigen durch aromatische Amine (BK 1301) auf, was sich an den 597 BK-Verdachtsanzeigen und den 19 als BK 1321 anerkannten Erkrankungen im Jahr 2024 ablesen lässt (DGUV 2024).
Wenn eine kombinierte inhalative und dermale Exposition gegenüber PAKs vorlag, werden die Einwirkungen anhand des BK-Reports „Ermittlung der Benzo[a]pyren-Dosis (BaP-Jahre)“ in der jeweils aktualisierten Fassung in Form der BaP-Jahre berechnet, wobei in der Richtwertdosis von 80 BaP-Jahren ein dermaler Anteil bereits berücksichtigt wurde (DGUV 2022, siehe Online-Quellen).
Ausschließlich dermale Expositionen werden von der BK 1321 nicht erfasst, da eine Quantifizierung der über die Haut aufgenommenen BaP-Mengen derzeit aufgrund fehlender wissenschaftlicher Daten noch nicht möglich ist. Zu Tätigkeiten mit ausschließlich dermaler Einwirkung gehören
laut BK-Report „Ermittlung der Benzo[a]pyren-Dosis (BaP-Jahre)”:
Hier soll durch den Präventionsdienst der dermale Kontakt qualitativ (Art, Dauer, Häufigkeit, betroffene Hautareale) beschrieben werden (DGUV 2022), auch wenn eine Anerkennung als BK 1321 nicht möglich ist.
BK 1108
Auch der Umgang mit Arsen über mehrere Jahre, der in der Regel nicht explizit bei der Anamneseerhebung abgefragt wird, kann Tumoren der ableitenden Harnwege verursachen, die dann bei entsprechender Exposition unter der BK 1108 „Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen“ als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt werden können (BMA 1964). Entsprechende berufliche Expositionen können durch die Verwendung arsenhaltiger Antifowling-Farben in Werften oder von arsenhaltigen Farbstoffen („Schweinfurter Grün“, alte Rezeptur), Arsen und Arsenverbindungen in Pflanzenschutzmitteln (in Deutschland seit 1976 verboten), arsenhaltige Holzschutzmittel oder Imprägnierungsmittel, arsenhaltige Ausgangsstoffe in der Pharmazie, in der chemischen, keramischen und Glasindustrie, Verhüttung und Rösten arsenhaltiger Mineralien entstehen beziehungsweise entstanden sein. So können unter anderem auch die Berufe als Winzer (z. B. durch die Verwendung arsenhaltiger Holzschutzmittel) oder als Präparatoren, die Arsen und Arsenverbindungen zur Haltbarmachung von Tierkörpern, Federn und Fellen verwenden, gefährdende Tätigkeiten beinhalten (Golka et al. 2021a; Hagemeyer et al. 2015; Henry u. Brüning 2012; Jungmann et al. 2022).
BK 1302
Eine weitere urologische Erkrankung auf dem Gebiet der Berufskrankheiten betrifft das beruflich bedingte Nierenzellkarzinom durch Trichlorethylen (syn. Trichlorethen), das unter der BK Nr. 1302 („Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe“) als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt werden kann (BMA 1985; BMAS 2018). Trichlorethylen wurde laut IARC (2014) in der Vergangenheit unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt: als Lösungsmittel für die Entfettung von Metallen, in Farben, Lacken, Pestiziden etc. und bis Mitte der 1950er Jahre als Lösungsmittel in der Trockenreinigung von Textilien, als intermediäre Chemikalie für die Herstellung von Polyvinylchlorid, chlorierten und fluorierten Kohlenwasserstoffen und in der Textilindustrie, unter anderem beim Färben von Textilien. Bei Patientinnen und Patienten mit Nierenzellkarzinom, die trichlorethylenbedingte Rauschzustände am Arbeitsplatz angeben, ist eine BK-Verdachtsanzeige zu stellen. In der wissenschaftlichen Stellungnahme zur BK 1302 werden folgende Voraussetzungen für die Anerkennung als Berufskrankheit aufgeführt:
Während Nierenzellkarzinome nach entsprechender Exposition gegenüber Trichlorethylen als BK 1302 anerkannt und entschädigt werden können, fehlen wissenschaftliche Belege, die eine Anerkennung von Tumoren der ableitenden Harnwege als BK 1302 ermöglichen.
BK 2402
Tumoren als Folge hoher Strahlenbelastung können als BK 2402 („Erkrankungen durch ionisierende Strahlen“) anerkannt und entschädigt werden (BMA 1991). Es liegt dazu eine umfangreiche wissenschaftliche Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS 2011b) vor, in der unter anderem ausgeführt wird, dass die Beurteilung der Strahleneinwirkung in der Regel schwierig sei und daher gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten der Strahlenbiologie, -physik und -epidemiologie erfolgen sollte. Im Rahmen einer Zusammenhangsbegutachtung bei Verdacht auf ein durch ionisierende Strahlen bedingtes Harnblasenkarzinom ist daher ein strahlenbiologisches Gutachten mit Bestimmung der Organdosis und einer Risikoabschätzung für die Harnblase zu erstellen.
Tumoren der ableitenden Harnwege als Folge der Therapie von Berufskrankheiten
Zytostatika wie Cyclophosphamid können zur Krebsentstehung an den ableitenden Harnwegen führen (Fairchild et al. 1979; Weistenhöfer et al. 2022). Wenn eine beispielsweise als BK 1318 („Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol“) anerkannte Erkrankung des hämatologischen/lymphatischen Formenkreises mit Substanzen therapiert würde, die Tumoren der ableitenden Harnwege induzieren können, wäre ein so entstandener Tumor der ableitenden Harnwege (Groot et al. 2018; Liang et al. 2017) gegebenenfalls als mittelbare BK-Folge zu diskutieren.
BK 4105 Mesotheliom der Tunica vaginalis testis
Die Tunica vaginalis testis ist eine Ausstülpung des Peritoneums. Hier können durch eine berufliche Asbestexposition Mesotheliome entstehen, die sehr selten sind, aber als Verdacht auf eine BK 4105 („Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards“; BMA 1993) angezeigt werden müssen (siehe auch Ebbinghaus et al. 2025 in dieser Ausgabe).
Harnblasenkarzinom als Folge von Arbeits- und Wegeunfällen
Nach länger als 10 Jahre bestehender beruflich bedingter Querschnittlähmung nach einem Arbeits- oder Wegeunfall können Tumoren der Harnblase auftreten, die als Unfallfolge entschädigt werden können (siehe auch Böthig et al. 2025 in dieser Ausgabe).
Weitere mögliche Berufskrankheiten
Nach beruflichen Auslandseinsätzen in Endemiegebieten ist die Anerkennung einer Bilharzioseinfektion als BK 3104 gegebenenfalls möglich („Tropenkrankheiten, Fleckfieber“; BMGS 2005).
In der Vergangenheit wurden nach einer sehr hohen unfallbedingten Exposition im Jahr 1953 gegen 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin Tumoren der ableitenden Harnwege aufgrund einer auf einer Konvention beruhenden Regelung der damaligen Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie (Nachfolger BG RCI) als BK 1310 („Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide“; BMA 1979) anerkannt (Nowak u. Barthelmes 2008; HVBG 2001; Zober et al. 1994). Es fehlen jedoch wissenschaftliche Belege, die eine Anerkennung von Tumoren der ableitenden Harnwege als BK 1310 rechtfertigen.
Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.
Literatur
Ärztlicher Sachverständigenbeirat: Wissenschaftliche Stellungnahme zu der Berufskrankheit Nr. 1301 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnblase durch aromatische Amine“. Gemeinsames Ministerialblatt 2011; 18.
BMA: Merkblatt zur BK Nr. 1301: „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine“ – Merkblatt zu BK Nr. 1 der Anl. 1 zur 7. BKVO. Bek. des BMA v. 12.6.1963. BArbBl Fachteil Arbeitsschutz 1963; 129f.
BMA: Merkblatt zur BK Nr. 1108: „Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen“ – Merkblatt zu BK Nr. 2 der Anl. 1 zur 7. BKVO. Bek. des BMA v. 19.05.1964. BArbBl Fachteil Arbeitsschutz 1964; 125f.
BMA: Merkblatt zur BK Nr. 1310: „Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide“. Bek. des BMA v. 10.07.1979. BArbBl 1979; 7/8.
BMA: Merkblatt zur BK Nr. 1302: „Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe“ – Merkblatt für die ärztliche Untersuchung. Bek. des BMA v. 29. März 1985, BArbBl 1985; 6.
BMA: Merkblatt zur BK Nr. 2402: „Erkrankungen durch ionisierende Strahlen“ – Merkblatt für die ärztliche Untersuchung. Bek. des BMA vom 13. Mai 1991. BArbBl 1991; 7–8: 72ff.
BMA: Merkblatt zu BK-Nr. 4105: „Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards“ – Merkblatt für die ärztliche Untersuchung. Bek. des BMA v. 8.11.1993 im Bundesarbeitsblatt 1994; 1: 67.
BMAS: Wissenschaftliche Stellungnahme zu der Berufskrankheit Nr. 1301 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnblase durch aromatische Amine“. GMBl 2011a; 18.
BMAS: Wissenschaftliche Stellungnahme zu der Berufskrankheit Nr. 2402 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung „Erkrankungen durch ionisierende Strahlen“. Bek. des BMAS vom 24.10.2011 – IVa 4-45222-2402. GMBl 2011b; 49–51: 983–993.
BMAS: Wissenschaftliche Begründung für die Berufskrankheit „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 80 Benzo(a)pyren-Jahren [(µg/m3) × Jahre]“. Bek. des BMAS vom 01.07.2016 – IVa4-45222-Harnblasenkrebs durch PAK – GMBl 2016a; 659–665.
BMAS: Wissenschaftliche Stellungnahme zu der Berufskrankheit Nr. 1301 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine“. Bek. des BMAS vom 12.09.2016 – IVa4-45222-1301 – GMBl 2016b; 770.
BMAS: Wissenschaftliche Stellungnahme zur Berufskrankheit Nr. 1302 „Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe“ – Nierenkrebs durch Trichlorethen. Bek. d. BMAS v. 1. Februar 2018 – IVa 4-45222 – 1302 – GMBl 2018; 12–13: 220–223.
BMGS: Merkblatt zu der BK Nr. 3104 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV): „Tropenkrankheiten, Fleckfieber“. Bek. des BMGS v. 01. Mai 2005, 414-45222-3104, Bundesarbeitsblatt 2005; 7: 48ff.
#Böthig R, Tahbaz, R, Fiebag K, Schöps W, Golka K: Unfallbedingte Querschnittlähmung und Harnblasenkarzinom. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60:xxx–xxx.
DGUV: Berufskrankheitengeschehen 2024. https://dguv.de/de/zahlen-fakten/bk-geschehen/index.jsp (abgerufen am 13.10.2025).
#DGUV (Hrsg.): Beth-Hübner M, Brandt B, Rupp R et al.: Aromatische Amine – Eine Arbeitshilfe in Berufskrankheiten-Ermittlungsverfahren (BK-Report 1/2019), Berlin, 2019. https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3520 (abgerufen am 13.10.2025).
#DGUV (Hrsg.): Teich E, Heinrich B: BK-Report 1/2022 – Ermittlung der Benzo[a]pyren-Dosis (BaP-Jahre), Berlin, 2022.https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/berufskrankheiten/… (abgerufen am 13.10.2025).
#Ebbinghaus-Mier D, Ebbinghaus R, Prager H-M, Schöps W, Golka K: Das Mesotheliom der Tunica vaginalis des Hodens – eine präoperativ meist nicht gestellte Diagnose. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60:xxx–xxx.
Fairchild WV, Spence CR, Solomon HD, Gangai MP: The incidence of bladder cancer after cyclophosphamide therapy. J Urol 1979; 122: 163–164.
#Golka K, Böthig R, Jungmann O, Forchert M, Zellner ME, Schöps W: Berufsbedingte Krebserkrankungen in der Urologie. Urologe A 2021; 60: 1061–1072.
Golka K, Schöps W: Aromatische Amine (BK 1301). In: Letzel S, Schmitz-Spanke S, Lang J, Nowak D (Hrsg.): Arbeit und Krebs. Arbeits- und sozialmedizinische Aspekte. Reihe Jahrestagung DGAUM (2021). Landsberg: ecomed Medizin, , S. 184–202.
Golka K, Schöps W, Felten C, Zellner M Berufsbedingte Urothelkarzinome. UROTOP 2019; 17, 3. Aufl. medac (leider nicht mehr online verfügbar).
Groot HJ, Lubberts S, de Wit R, Witjes JA, Kerst JM, de Jong IJ, Groenewegen G, van den Eertwegh AJM, Poortmans PM, Klümpen HJ, van den Berg HA, Smilde TJ, Vanneste BGL, Aarts MJ, Incrocci L, van den Bergh ACM, Jóźwiak K, van den Belt-Dusebout AW, Horenblas S, Gietema JA, van Leeuwen FE, Schaapveld M: Risk of solid cancer after treatment of testicular germ cell cancer in the platinum era. J Clin Oncol 2018; 36: 2504–2513.
Hagemeyer O, Weiß T, Marek E, Merget R, Brüning T: Harnblasenkrebs durch Arsen bei einer Museumsrestauratorin. IPA-Journal 2015; 3: 6–9. https://www.dguv.de/medien/ipa/publikationen/ipa-journale/ipa-journale2… (abgerufen am 13.10.2025).
Henry J, Brüning T: Unterschätzte Gefahr durch arsenhaltige Holzimprägnierungsmittel. IPA-Journal 2012; 2: 6–8.
HVBG: Info 10/2001 vom 06.04.2001, S. 0930–0937, DOK 376.3-1310 Lungenkrebs nicht Folge einer Berufskrankheit Nr. 1310 – Urteil des LSG Niedersachsen vom 30.08.2000 – L 6/3 U 189/96 – VB 48/2001.
IARC: Trichloroethylene, tetrachloroethylene, and some other chlorinated agents. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 106, 2014. https://publications.iarc.who.int/Book-And-Report-Series/Iarc-Monograph… (abgerufen am 13.10.2025).
#Jungmann OP, Schöps W, Weistenhöfer W, Forchert M, Golka K: Wann sind der Verdacht auf eine Berufskrankheit oder urologische Folgen eines Arbeitsunfalls anzuzeigen? Rechtlicher Hintergrund, ärztliche Pflichten und Ablauf des Verfahrens. Urologie 2022; 61: 1186–1196.
Liang F, Zhang S, Xue H, Chen Q: Risk of second primary cancers in cancer patients treated with cisplatin: a systematic review and meta-analysis of randomized studies. BMC Cancer 2017; 17: 871.
Nowak D, Barthelmes C: Berufliche Risikofaktoren, Berufskrankheit, arbeitsmedizinische Begutachtung. In: Tumorzentrum München MANUAL Urogenitale Tumoren. Tumorzentrum-München und W. Zuckerschwerdt Verlag München, 2008. https://cdn.lmu-klinikum.de/f93dfe796b5fc8d9/88bcd89ec96b/941_Urogenita… (abgerufen am 13.10.2025).
#Weistenhöfer W, Golka K, Bolm-Audorff U, Bolt HM, Brüning T, Hallier E, Pallapies D, Prager H-M, Schilling T, Schmitz-Spanke S, Uter W, Weiß T, Drexler H: Das beruflich bedingte Harnblasenkarzinom. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2022; 57: 177–189; MedSach 2022; 118: 79–93.
Zober A, Ott MG, Messerer P: Morbidity follow up study of BASF employees exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) after a 1953 chemical reactor incident. Occup Environ Med 1994; 51: 479–486.
Online-Quellen
DGUV (Hrsg.): Teich E, Heinrich B: BK-Report 1/2022 – Ermittlung der Benzo[a]pyren-Dosis (BaP-Jahre), Berlin 2022
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/berufskrankheiten/…
DGUV (Hrsg.): Beth-Hübner M, Brandt B, Rupp R et al.: Aromatische Amine – Eine Arbeitshilfe in Berufskrankheiten-Ermittlungsverfahren (BK-Report 1/2019), Berlin, 2019
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3520.
Koautoren
Prof. (em.) Dr. med. Hans Drexler
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (IPASUM), Erlangen
Olaf P. Jungmann
Urologische Gutachtenpraxis Köln/Bonn
Dr. med. Wolfgang Schöps
Urologische Praxis, Sankt Augustin
Prof. Dr. med. Bernd Wullich
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Urologische und Kinderurologische Klinik, Uniklinikum Erlangen
Dr. med. Michael Zellner
Abteilung Urologie | Neuro-Urologie, KWA Klinik Stift Rottal, Bad Griesbach
Prof. Dr. med. Klaus Golka
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo), Dortmund