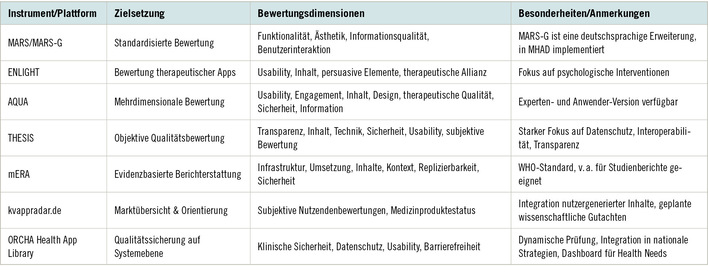Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
Occupational safety at workplaces in workplaces that are not fully enclosed and at workplaces outdoors
Basic occupational health and safety requirements for professional outdoor activities are contained in Section 5.1 of the appendix to the Workplace Ordinance. A technical rule for workplaces has been developed that applies to hazards caused by weather. Assessment criteria have been established for natural UV radiation, precipitation, wind forces, as well as thunderstorms and lightning strikes. Employers must consider measures to protect employees in outdoor workplaces.
Arbeitsschutz bei Arbeitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und bei Arbeitsplätzen im Freien
Grundlegende Abforderungen an den Arbeitsschutz für Tätigkeiten im Freien enthält der Anhang der Arbeitsstättenverordnung im Abschnitt 5.1. Hierzu wurde eine Regel für Arbeitsstätten entwickelt, die bei Gefährdungen durch das Wetter gilt. Für natürliche UV-Strahlung, Niederschlag, Windkräfte sowie Gewitter und Blitzschlag sind Beurteilungsmaßstäbe festgelegt. Arbeitgeber haben an Arbeitsplätzen im Freien Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu berücksichtigen.
Kernaussagen
Entstehung der ASR und Empfehlungen
Die Arbeitsstättenverordnung enthält im Anhang im Abschnitt 5 ergänzende Anforderungen und Maßnahmen für besondere Arbeitsstätten und Arbeitsplätze, darunter als Abschnitt 5.1: „Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien sind so einzurichten und zu betreiben, dass sie von den Beschäftigten bei jeder Witterung sicher und ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, benutzt und wieder verlassen werden können. Dazu gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witterungseinflüsse geschützt sind oder den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden. Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplätze nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Beschäftigten nicht gesundheitsgefährdenden äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.“
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung einschließlich ihres Anhangs festzulegen. Dabei sollen insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse berücksichtigt werden. Bei Einhaltung der Regeln durch den Arbeitgeber kann er davon ausgehen, dass die Anforderungen der Verordnung erfüllt sind (Vermutungswirkung).
In der bis 2004 gültigen Arbeitsstättenverordnung war für ortsgebundene Arbeitsplätze im Freien vorgeschrieben, dass diese Arbeitsplätze in der Zeit vom 1. November bis 31. März bei Außentemperaturen von weniger als +16 °C zu beheizen sein müssen, wenn dort Arbeitnehmende nicht nur vorübergehend leichte körperliche Arbeit leisten. Zusätzliche Erkenntnisse in Form einer Arbeitsstätten-Richtlinie wurden den Arbeitgebern damals für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsplätzen im Freien nicht zur Verfügung gestellt.
Ein Arbeitsauftrag für den Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) in seiner 4. Berufungsperiode ist die Erstellung einer Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) zur Untersetzung des Abschnitts 5.1. Im Jahr 2020 wurde die Projektbeschreibung zur ASR A5.1 „Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien“ durch den ASTA beschlossen und eine Projektgruppe eingerichtet. Sie setzt sich aus Fachexpertinnen und -experten zusammen, die die Interessen der fünf Bänke im ASTA (Arbeitgeber, Gewerkschaften, Länderbehörden, gesetzliche Unfallversicherung und Wissenschaft) einbringen. Der Projektauftrag beschränkt sich, vorgegeben durch den Text des Abschnitts 5.1, auf witterungsbedingte Gefährdungen. Luftschadstoffe (z. B. Ozon, Brennhaare des Eichenprozessionsspinners) sollen nicht betrachtet werden.
Die Projektgruppe ermittelte sechs witterungsbedingte Gefährdungen: natürliche UV-Strahlung, Hitze, Kälte, Niederschlag, Windkräfte sowie Gewitter und Blitzschlag. Zu jeder Gefährdung wurden Beurteilungsmaßstäbe gemäß der ASR V3 „Gefährdungsbeurteilung“ ermittelt. Hierbei wurde angestrebt, vereinfachte Beurteilungsmaßstäbe heranzuziehen, die die komplexen physikalischen und physiologischen Zusammenhänge zwischen Wetter und teilweise schwer arbeitenden Beschäftigten ausreichend genau berücksichtigen. Der Arbeitgeber soll in die Lage versetzt werden, mit einfachen Mess- und Bewertungsmethoden das Ausmaß der jeweiligen Gefährdung erkennen zu können, um geeignete Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen. Umfangreiche Maßnahmenvorschläge entsprechend des TOP-Prinzips ergänzen die ASR A5.1. Das Thema Substitution wird nicht behandelt, da dann die Arbeitsplätze in umschlossenen Räumen liegen müssten und der Anwendungsbereich der ASR A5.1 verlassen werden würde.
Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens zum Entwurf der ASR A5.1 wurden beschlossen, die Inhalte der Abschnitte Hitze und Kälte zunächst nur als Empfehlungen des ASTA zu gestalten. Die abschließenden Beschlussfassungen hierzu stehen noch aus. Der ASTA hat jedoch in seiner 12. Sitzung am 3. April 2025 die ASR A5.1 beschlossen. Die Bekanntgabe durch das BMAS ist zeitgleich mit Veröffentlichung der beiden Empfehlungen geplant.
Allgemeiner Teil der ASR A5.1
Die ASR A5.1 besteht einleitend aus den Abschnitten „Zielstellung“, „Anwendungsbereich“, „Begriffsbestimmungen“ sowie „Allgemeines zur Beurteilung von Gefährdungen durch witterungs- und wetterbedingte äußere Einwirkungen“. Während die ersten drei Abschnitte dem üblichen Aufbau einer ASR entsprechen, wird im vierten Abschnitt alles zusammengefasst, was für alle der nachfolgend im Einzelnen behandelten Gefährdungen gilt.
Der Abschnitt 2 „Anwendungsbereich“ nennt die nun in der ASR behandelten Gefährdungsfaktoren natürliche UV-Strahlung, Niederschlag, Windkräfte sowie Gewitter und Blitzschlag. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Informationen zur Beurteilung der Gefährdungen durch Hitze und Kälte sowie zur Ableitung von Maßnahmen in den „Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) enthalten sind.
In der ASR liegt der Schwerpunkt auf den Arbeitsplätzen im Freien. Hier sind die höchsten Belastungen der Beschäftigten zu erwarten. In Abschnitt 4 ist geregelt, dass, falls Beschäftigte vergleichbaren gesundheitsgefährdenden äußeren Einwirkungen an Arbeitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten ausgesetzt sind, relevante Gefährdungen wie bei Arbeitsplätzen im Freien zu betrachten sind. Für gesundheitlich vorbelastete oder besonders schutzbedürftige Beschäftigten (z. B. Jugendliche, Schwangere, stillende Mütter) wird hinsichtlich möglicher weitergehender Maßnahmen eine arbeitsmedizinische Beratung empfohlen. Bei allen Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass das Wetter die Verhältnisse beeinflusst. Wichtig ist die jahreszeitlich abgestimmte Unterweisung. Da im Freien die individuell wirkenden personenbezogenen Maßnahmen wichtig sind – hierzu zählen unter anderem das Anpassen von Verhalten (z. B. ausreichende Flüssigkeitsaufnahme bei Hitze), Nutzung geeigneter Kleidung oder das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) –, erinnert die ASR A5.1 daran, dass Beschäftigte ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Arbeitsschutzgesetz nachzukommen haben.
Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung
Ziel der ASR A5.1 bezogen auf die Einwirkung von natürlicher UV-Strahlung ist es, durch Minimierung der beruflichen UV-Gesamtdosis akute und chronische Gesundheitsschäden, insbesondere Schäden an Haut und Augen, zu vermeiden.
Um die Anwendung der ASR für die Nutzenden so einfach wie möglich zu gestalten, soll der UV-Index als etablierter Bewertungsmaßstab zur Ermittlung der Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung angewendet werden. Vorteil ist, dass er aktuell und als Prognose auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und beim Deutschen Wetterdienst (DWD) (s. Online-Quellen) öffentlich zugänglich für viele Orte in Deutschland abgerufen werden kann. In gewissen Expositionssituationen, zum Beispiel in großen Höhen über dem Meeresspiegel, können ergänzende Messungen vor Ort zur Berechnung des lokalen UV-Index zweckmäßig sein.
Die Beurteilung der Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung richtet sich nach dem zu erwartenden lokalen Höchstwert des UV-Index während der Tätigkeit. Durch den Tagesverlauf des UV-Index können somit Tätigkeiten, die nur in Tagesrandzeiten durchgeführt werden, beispielsweise eine Serviertätigkeit im Biergarten ab 16:00 Uhr, mit geringeren Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten durchgeführt werden, auch wenn der UV-Index in den sommerlichen Mittagstunden hohe Werte erreicht hat.
Die ASR A5.1 fordert, dass ab einem UV-Index von 3 Maßnahmen gemäß dem TOP-Prinzip (technische, organisatorische, persönliche) zu ergreifen sind. Diese und höhere UV-Indices sind in den Monaten März bis Oktober zu erwarten. Ab einem UV-Index von 8, mit dem in Deutschland in den Sommermonaten Juni und Juli immer zu rechnen ist, der aber vereinzelt im Tagesverlauf auch in den davor- und danach liegenden Monaten auftreten kann, legt die ASR A5.1 fest, dass personenbezogene Maßnahmen zwingend erforderlich sind. Der Arbeitgeber sollte auch prüfen, ob eine arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß AMR 13.3 „Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natürliche UV-Strahlung von regelmäßig einer Stunde oder mehr je Tag“ erforderlich ist. Der UV-Index berücksichtigt nicht individuelle und situative Empfindlichkeiten wie zum Beispiel Hauttyp oder Tätigkeiten mit photosensitiven Stoffen. Gegebenenfalls ist in solchen Fällen eine arbeitsmedizinische Beratung sinnvoll.
Durch eine sachgerechte Verknüpfung von technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen kann ein wirkungsvoller Schutz vor natürlicher UV-Strahlung erreicht werden. Die ASR A5.1 enthält umfangreiche Maßnahmenvorschläge. Als technische Maßnahme zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung ist eine Verschattung vorzusehen, fest installiert in Form von Einhausungen oder Überdachungen, oder bei ortsveränderlichen Arbeitsplätzen im Freien durch ausreichend große Sonnenschirme oder Sonnensegel mit hohem UV-Schutz. Bei diesen technischen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich der Beschäftigten kein Hitzestau entsteht.
Die wichtigste organisatorische Maßnahme ist die Verringerung der Aufenthaltszeit in der Sonne, insbesondere zu Tageszeiten mit hohem UV-Index. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise die Verlagerung von Tätigkeiten in jeweils schattige Bereiche oder in die Morgen- und Abendstunden. Auch die Verteilung der Tätigkeiten auf mehrere Beschäftigte und die Durchführung von Ruhepausen ohne Belastung durch natürliche UV-Strahlung schützen.
Personenbezogene Maßnahmen lassen sich an Arbeitsplätzen im Freien nicht umgehen, da nicht immer und überall technische und organisatorische Maßnahmen durchführbar sind, die Gefahrenquelle Sonne jedoch nicht abgeschaltet werden kann. Die wichtigste personenbezogene Maßnahme ist körperbedeckende Kleidung aus dicht gewebten Stoffen (UV-Schutzkleidung ist nicht erforderlich) und der Schutz des Kopfes einschließlich Nacken- und Ohrenschutz. Sofern Körperstellen nicht durch Kleidung oder Kopfbedeckung geschützt werden können, wie Gesicht oder Hände, sind wasserfeste Sonnenschutzmittel mit einem hohen bis sehr hohen Lichtschutzfaktor (mindestens 30, besser 50+) einschließlich ausreichendem UV-A-Filter anzuwenden.
Wenn die Gefahr der Blendung besteht, ergänzen Sonnenschutzbrillen mit getönten Gläsern den Schutz. Mehrere Hinweise unterstützen den Arbeitgeber bei der Auswahl, weil die Sonnenschutzbrillen für die jeweilige berufliche Tätigkeit geeignet sein müssen.
Da die personenbezogenen Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers resultieren, regelt die ASR A5.1, dass neben PSA den Beschäftigten auch Sonnenschutzmittel kostenfrei zur Verfügung zu stellen sind.
Gefährdungen durch Niederschlag
Als Gefährdungen durch Niederschlag behandelt die ASR Regen, Schnee sowie Glätte und Glatteis. Hagel tritt nur zusammen mit Gewittern auf und wird dort mitberücksichtigt. Niederschlag kann beim gleichzeitigen Einwirken anderer Witterungseinflüsse weitere Gefährdungen zur Folge haben, zum Beispiel erhöhte natürliche UV-Strahlung durch Reflexionen bei einer geschlossenen Schneedecke.
Um die Beurteilungsmaßstäbe so einfach wie möglich zu halten, greift die ASR auf die Warnstufen des DWD zurück. Ergänzend dient die Beobachtung der Wetterentwicklung am Ort der Tätigkeit zur Beurteilung der Lage.
Die Niederschlagsformen sind in der ASR jeweils in drei Intensitätsstufen kategorisiert, die mit Handlungsanweisungen unterlegt sind. In der niedrigsten Intensitätsstufe besteht keine amtliche Warnung für die jeweilige Niederschlagsform. Da die Witterungsbedingung nicht ungewöhnlich ist, sind „bei gesundem Menschenverstand“, das heißt, Bekleidung, Ausrüstung und Verhalten entsprechen den zu erwartenden Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz, keine Gefährdungen zu erwarten. Die Wetterentwicklung ist jedoch zu verfolgen. Die nächste Intensitätsstufe entspricht den DWD-Warnstufen 1 und 2.
Die Witterungsbedingungen sind ebenfalls nicht ungewöhnlich, aber potenziell gefährdend. Eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber der Wetterentwicklung ist erforderlich und bei Verschlechterung der Lage sind die Beschäftigten zu informieren. Die höchste Intensitätsstufe entspricht den DWD-Warnstufen 3 und 4, oft verbunden mit einer amtlichen Unwetterwarnung. Da die erwartete Wetterentwicklung sehr bis extrem gefährlich ist und auch Lebensgefahr bestehen kann, regelt die ASR, dass die Auswirkungen der Gefährdung durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu reduzieren ist, sonst sind Aufenthalte und Tätigkeiten im Freien einzustellen.
In diesem Abschnitt der ASR werden die Maßnahmen nach den Folgen von Niederschlag – Rutschgefahr, Sichteinschränkungen und mechanische Einwirkungen – unterschieden. Bei Maßnahmen gegen Rutschgefahr soll der Arbeitgeber seine Möglichkeiten zur technischen oder organisatorischen Gestaltung der Arbeitsplatzumgebung nutzen. Entsprechend des TOP-Prinzips sind auf dem eigenen Betriebsgelände technische Maßnahmen (z. B. Überdachungen, Tausprühanlagen) bevorzugt umzusetzen. So wird eine dauerhafte Reduzierung der gefährdenden Einflüsse erreicht.
Sichteinschränkungen, die sowohl direkt durch Regen, Schneefall oder Nebel als auch durch Blendungen (geschlossene Schneedecke), Spiegelungen (Reflektionen in Wasserflächen) oder Flimmern (Eisnadeln, Diamantstaub, Polarschnee) auftreten und mit Wind sich verstärken können, erfordern gemäß der ASR A5.1 insbesondere bei Alleinarbeit technische und organisatorische Maßnahmen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie ein zusätzliches Meldesystem oder eine Begleitperson verhindern, dass gefährliche Alleinarbeit entsteht. Diese ist immer über den Zeitraum der vorliegenden Sichteinschränkungen einzustellen.
Als mechanische Einwirkung infolge von Niederschlag betrachtete die ASR unter anderem Eiszapfen und Dachlawinen, die von Gebäuden oder Bäumen herabfallen. Auch das Festfrieren an metallischen Gegenständen, wenn sie unter dem Gefrierpunkt mit nackten Händen berührt werden, zählt als mechanische Einwirkung.
Die wichtigste Maßnahme ist die sichere Beseitigung von Eiszapfen und Schneelasten. Falls dies nicht möglich ist, sind die Gefahrenbereiche gegen Betreten abzusperren. Beim Betreten von Dächern kann eine Schneedecke über nicht betretbare Dachteile zu zusätzlichen Gefahren führen. (Hinweis des Autors: Die ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ enthält weitere Regelungen.)
Als personenbezogene Maßnahme gegen mechanische Einwirkungen aus der Kombination von Niederschlag und Wind führt das Tragen einer Schutzbrille zum Schutz der Augen und Verringerung des Lidschlussreflexes. So werden auch die Folgen von Sichteinschränkungen reduziert.
Gefährdungen durch Windkräfte
Gefährdungen durch Windkräfte schließen die direkten Auswirkungen bewegter Luftmassen, die Einwirkungen kleiner Teile, die durch Wind aufgewirbelt werden, störende Windgeräusche und Folgegefährdungen von Wind mit Sturmstärke mit ein.
Um die Beurteilung der Windstärke möglichst einfach zu halten, stützt die ASR sich auf die Beaufort-Skala beziehungsweise die Beaufort-Skala See. Beide Skalen befinden sich im Anhang der Regel. Die beobachtbaren Veränderungen der Umgebung lassen hinreichend genau auf die aktuelle Windstärke schließen. Das Warnstufensystem des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Windböen darf nur zur orientierenden Information, für die Arbeitsorganisation und für die Einsatzplanung herangezogen werden. Zum einen fehlt die räumliche Genauigkeit, zum anderen sieht die ASR eine Kategorisierung von Intensitätsstufen für Windkräfte vor, deren geringste Intensitätsstufe schon bei Windstärken unterhalb der ersten Warnstufe des DWD beginnt. Wenn der Arbeitgeber eine Wetterstation mit Windgeschwindigkeitsmessung vor Ort betreibt, liegen die genauesten Informationen vor.
Tabellarisch sind die drei Intensitätsstufen für Windkräfte mit einer Beschreibung der Auswirkungen und den zugehörigen Windstärken beziehungsweise Windgeschwindigkeiten erläutert. Bei der Intensitätsstufe I, gültig bei den Beaufort-Graden 6 bis 7, sind die Tätigkeiten behindert, Arbeitsmittel können zum Teil schwingen und nicht mehr betreibbar sein (z. B. Leitern, Krane, Hubarbeitsbühnen). Die Beschreibung der Intensitätsstufe II zeigt, dass an Arbeitsplätzen im Freien nicht mehr gearbeitet werden kann und eine Verletzungsgefahr besteht, vor der noch ein Schutz in Fahrzeugen möglich ist. Bei der Intensitätsstufe III, gültig ab Beaufort-Grad 11, ist kein Aufenthalt im Freien mehr möglich und nur in massiven Gebäuden besteht ein Schutz vor möglicherweise tödlichen Verletzungen.
Als technische Maßnahmen gegen Windkräfte enthält die ASR Anregungen zur statischen Sicherung von Gebäuden und Bauteilen, zur Verhinderung der unkontrollierten Bewegung von Gegenständen und zur Installation technischer Einrichtungen zum Schutz der Beschäftigten, wenn Windkräfte auf sie einwirken und sie stürzen könnten. Auch die Pflasterung oder Befestigung der Arbeitsplatzumgebung auf dem Betriebsgelände, damit nicht Staub oder Teilchen aufwirbeln, kann eine effektive Maßnahme sein.
Die Tätigkeit an die Gegebenheiten anzupassen und damit rechtzeitig zu beginnen, ist die wichtigste organisatorische Maßnahme. Vorgesehene technische Maßnahmen zur Verhinderung der unkontrollierten Bewegung von Gegenständen müssen umgesetzt werden (z. B. Schutznetze entsprechend anbringen). Beim Einsatz von Arbeitsmitteln sind die Herstellerangaben zu den Einsatzgrenzen zu beachten.
Die personenbezogenen Maßnahmen gegen Windkräfte umfassen die Nutzung von PSA wie Schutzbrille oder Staubschutzmaske. Sofern Tätigkeiten noch möglich sind, ist ein erhöhter Wert auf Eigensicherung zu legen. Schwingende Teile, peitschende Leinen oder Tätigkeiten auf höhergelegen Bereichen des Arbeitsplatzes erhöhen die Verletzungsgefahr. Beschäftigte sollen immer rechtzeitig den Gefahrenbereich verlassen und geschützte Bereiche und Einrichtungen aufsuchen.
Gefährdungen durch Gewitter und Blitzschlag
Die Gefährdung durch Gewitter und Blitzschlag besteht vorwiegend in den Monaten Mai bis August, lässt sich aber bei bestimmten Wetterlagen nicht zu jeder Jahreszeit ausschließen.
Die Vorhersage von Gewittern ist noch nicht so weit ausgereift, dass die spontane Entstehung örtlich begrenzter Gewitter per Wettervorhersage oder App ausreichend genau berücksichtigt werden kann. Insofern sind Beobachtung und Einschätzung der aktuellen Wettersituation vor Ort ausschlaggebend. Beschäftigte müssen rechtzeitig gewarnt werden, damit sie einen sicheren Ort bei Blitzschlaggefahr aufsuchen können.
Hierzu muss der Arbeitgeber drei Fragen zum Beurteilen der Gefährdung durch Blitzschlag beachten:
Die Reichweite eines Blitzes als natürliches physikalisches Phänomen ist nicht genau vorherzusagen. In der ASR wird deshalb vorgeschlagen, die Gefährdung durch Blitzschlag als gering, hoch und sehr hoch einzustufen. Mithilfe von zwei Beurteilungsmaßstäben kann die Einstufung mit zwei unterschiedlichen Verfahren ermittelt werden.
Das optisch-akustische Verfahren verknüpft die Wahrnehmbarkeit von Donner und Blitzereignis mit Zeiten, sowohl zwischen Donner und Blitz als auch nach Durchzug des Gewitters. Bei weniger als 10 Sekunden Zeit zwischen Blitz und Donner liegt eine sehr hohe Blitzschlaggefahr vor. Sofern der
Arbeitgeber ein System zur Feldstärkemessung installiert hat, gibt der Wert der örtlich ermittelten elektrischen Feldstärke die Einstufung vor. Die sehr hohe Blitzschlaggefahr beginnt ab einer Feldstärke von mehr als
5000 V/m.
Die einzig wirksame technische Maßnahme gegen Blitzschlaggefahr ist die Gestaltung eines sicheren Ortes. Bei diesem werden die beim Blitzeinschlag auftretenden Ströme um ihn herumgeleitet. Beschäftigte in ihm sind nicht gefährdet. Nicht allseits umschlossene Arbeitsstätten sollten immer als sicherer Ort bei Blitzschlaggefahr eingerichtet werden, damit auch bei Gewitter darin weitergearbeitet werden kann.
Organisatorisch sind als Maßnahmen vorzusehen, dass die Beschäftigten vor der Blitzschlaggefahr unverzögert gewarnt werden und sie die Tätigkeiten sofort einstellen. Mitunter muss mit einer Vorlaufzeit gewarnt werden, damit sie die vorgesehenen sicheren Orte bei Blitzschlaggefahr rechtzeitig erreichen können.
Die einzig wirksame personenbezogene Maßnahme besteht darin, dass die Beschäftigten die vorgegebenen organisatorischen Maßnahmen bei Blitzschlaggefahr unverzüglich zu befolgen haben und sich am
sicheren Ort entsprechend verhalten. Eine Reaktion im Moment des Blitzschlages ist nicht mehr möglich. Trotzdem enthält die ASR Verhaltensregeln, falls ein sicherer Ort nicht erreicht wird und die Beschäftigten sich weiterhin im Freien aufhalten müssen. Diese Verhaltensregeln entsprechen den bekannten Hinweisen an die Bevölkerung zum Schutz bei Gewitter.
Arbeiten im Freien
Die ASR A5.1 gilt nur für Arbeitsplätze, die sich an Orten im Freien auf dem Gelände eines Betriebs oder auf Baustellen befinden. Für andere Arbeiten im Freien, zum Beispiel Gärtnerarbeiten auf Privatgrundstücken, sollten die Erkenntnisse aus dieser ASR im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz als Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene berücksichtigt werden.
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.
Online-Quellen
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): Optische Strahlung
www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/uv-index_node.html
Deutscher Wetterdienst: Vorhersagen des UV Index und der UV Dosis für wolkenlosen und für bewölkten Himmel
https://kunden.dwd.de/uvi_de
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/BJNR124610996.html
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/ArbSt%C3%A4ttV.pdf…;
Ergänzende Infos der ASU-Redaktion
Inzwischen sind die ASR 5.1 „Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien“ sowie die zugehörigen ASTA-Empfehlungen zu Hitze und Kälte auf den Internetseiten der BAuA unter „Arbeitsstätten“ verfügbar:
ASR A5.1:
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-A5-1
ASTA Empfehlungen zu Hitze und Kälte:
https://www.baua.de/DE/Die-BAuA/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschu…
Der Ausschuss für Arbeitsstätten will die Erfahrungen bei der Nutzung der beiden Empfehlungen sammeln. Bitte übermitteln Sie diese an die ASTA-Geschäftsstelle unter der folgenden Mailadresse:
ausschuss.asta@baua.bund.de