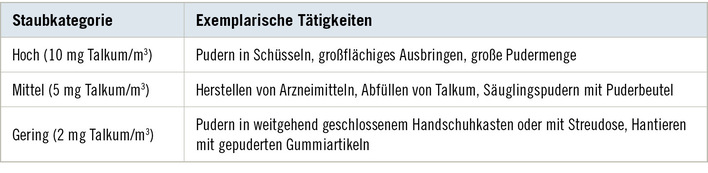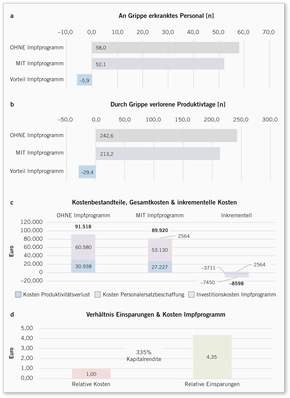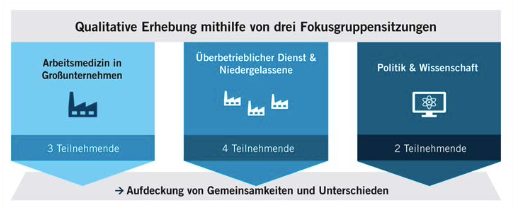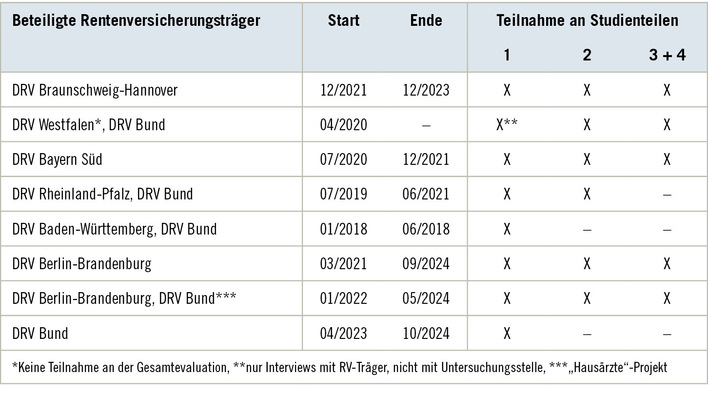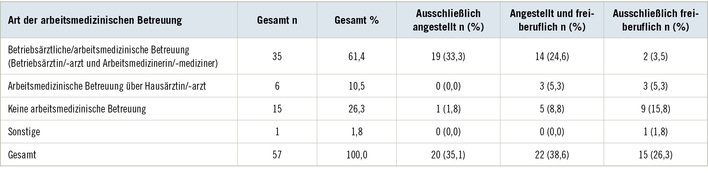Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
The BAKI project
BAKI is an innovative project, which is carried out by the University Medical Center Göttingen and the University of Würzburg. It addresses a group which is currently often not accessible by occupational care, virtual workers. Virtual work is defined as work arrangements where information- and communication technologies are central to the work itself. This is often related to a physical dispersion since collaboration no longer requires employees to work in the same building. Because of this, labour protection guidelines often do not apply, and occupational doctors have no access to these employees. BAKI aims to improve this by developing two new digital tools. BAKI-AI is a learning algorithm, which will give employees personalised feedback on their work-related resources, demands and recommended occupational care methods. To train this algorithm, a big dataset from virtual workers in Germany will be required. For this, a multimodal data collection approach was devised. Using both questionnaires and sensors, multiple physiological and psychological aspects of work will be captured. After the development of BAKI-AI, the virtual interaction platform BAKI-social will be developed. BAKI-social will combine aspects of virtual and extended reality in order to provide a more in-depth interaction between virtual employees and occupational doctors. By combining occupational medicine and artificial intelligence, BAKI aims to develop a new field of study and take a step towards the future of occupational care.
Keywords: occupational medicine – artificial intelligence – extended reality – health
ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 557–559
Das BAKI-Projekt
Das Projekt BAKI, das gemeinsam von der Universitätsmedizin Göttingen und der Universität Würzburg durchgeführt wird, adressiert eine Zielgruppe, die aktuell oft nur schwer zugänglich ist – virtuelle Beschäftigte. Damit sind Beschäftigungsverhältnisse gemeint, in denen Informations- und Kommunikationstechnologien ein zentraler Aspekt der Arbeit sind. Häufig geht dies mit einer örtlichen Dezentralisierung einher, da effiziente Kollaboration keine physikalische Nähe mehr voraussetzt. Das bringt neue Herausforderungen für die Arbeitsmedizin mit sich, da Beschäftigte für Betriebsärztinnen und -ärzte oft nicht zugänglich sind. Außerdem greifen Richtlinien des Arbeitsschutzes häufig nicht. Im Zuge des BAKI-Projekts werden zwei digitale Tools entwickelt, die die Versorgung von virtuell Beschäftigten verbessern sollen. BAKI-AI ist ein lernender Algorithmus, der Beschäftigten Feedback über persönliche Ressourcen und Anforderungen gibt und entsprechende BGM-Maßnahmen vorschlagen wird. Der Algorithmus wird mit einem großen Datensatz deutscher Beschäftigter trainiert. Dafür werden physiologische und psychologische Daten mit Fragebögen und diversen Sensoren, wie etwa Smartwatches, erhoben. Im Anschluss wird BAKI-social entwickelt – eine virtuelle Umgebung, die Aspekte der erweiterten Realität nutzt, um die Interaktion zwischen Betriebsärztinnen/-ärzten und virtuellen Beschäftigten zu verbessern. Virtuelle Umgebungen können in der Medizin vielseitig angewandt werden und unter anderem für bessere Visualisierungen und tiefere Interaktionen mit örtlich verteilten Patientinnen und Patienten genutzt werden. Durch die Kombination von Arbeitsmedizin und künstlicher Intelligenz schafft BAKI ein neues Forschungsfeld und einen Weg in die Zukunft für die Versorgung von Beschäftigten.
Schlüsselwörter: Arbeitsmedizin – Künstliche Intelligenz – erweiterte Realität – Gesundheit
Einleitung
Die Nachwuchsgruppe BAKI (Betriebsärztliches Handeln: zukunftsorientiert, interdisziplinär und evidenzbasiert mit KI) wird von der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) im Rahmen des FoGA-Programms (Förderung der Forschung und Lehre zur Gesundheit in der Arbeitswelt) gemeinsam mit dem BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) gefördert. Das FoGA-Programm dient der Stärkung von Forschungsstrukturen in den Bereichen Arbeit und Gesundheit und zielt darauf ab, Defizite in der Lehre und der Nachwuchsförderung zu verbessern. Die Gruppe bildet einen Zusammenschluss des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Präventivmedizin der Universitätsmedizin Göttingen und der Arbeitsgruppe für die Psychologie Intelligenter Interaktiver Systeme der Universität Würzburg. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen die Forschungsbereiche der Arbeitsmedizin und der künstlichen Intelligenz zusammengebracht werden und so ein neues Feld entstehen. Im Zuge des Projekts werden innovative Tools entwickelt, die die Gesundheit von Beschäftigten verbessern sollen. Zusätzlich werden durch Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung neuer Lehrinhalte interdisziplinäre Kompetenzen nach außen getragen und die Projektergebnisse in die Praxis transferiert.
Problemstellung
Bei virtuellen Beschäftigten handelt es sich um eine Zielgruppe, die in der Arbeitsmedizin aktuell oft nur schwer zu erreichen ist (Wütschert et al. 2022). In diesen Beschäftigungsverhältnissen stellen Informations- und Kommunikationstechnologien einen zentralen Aspekt der Arbeit dar und beeinflussen maßgeblich, wie Beschäftigte miteinander kommunizieren und Aufgaben ausführen (Orlikowski u. Scott 2016). Virtuelle Arbeit geht häufig mit einer örtlichen Dezentralisierung einher, da Beschäftigte nicht mehr gemeinsam in einem Büro vor Ort sein müssen, um effizient zusammenzuarbeiten (Hossain and Wigand 2004). Diese Flexibilisierung der Arbeit öffnet die Tür für neue Lebensweisen, wie Homeoffice oder dem digitalen Nomadentum (Marx et al. 2023).
Virtuelle Arbeit hat viele Vorteile, stellt die Beschäftigten allerdings auch vor neue Herausforderungen. Virtuelle Beschäftigte sind für
Betriebsärztinnen und -ärzte oft nur schwer zugänglich (Wütschert et al. 2022). Außerdem fehlt es Betriebsärztinnen und -ärzten an evidenzbasierten Tools für die Betreuung virtueller Beschäftigter
(VII. Technischer und organisatorischer Arbeitsschutz in der digitalisierten Arbeitswelt 2022) und viele Lösungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes greifen bei diesen Beschäftigten nicht (Bretschneider et al. 2020). An dieser Forschungslücke setzt BAKI an und erzeugt neben evidenzbasierten, innovativen Tools neue Erkenntnisse über die Faktoren, die die Gesundheit in virtuellen Beschäftigungsverhältnissen beeinflussen.
Methodische Konzeption und Design
Im Zentrum von BAKI stehen zwei digitale Tools, die im Laufe des Projekts entwickelt werden: BAKI-AI und BAKI-social.
Bei BAKI-AI handelt es sich um einen lernenden Algorithmus, der Beschäftigten nach einer kurzen Eingabe Feedback über ihre individuelle Arbeitsumgebung, persönliche Ressourcen- und Gefährdungen sowie Vorschläge für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen gibt. Dies soll es Beschäftigten ermöglichen, unkompliziert und schnell eine Rückmeldung über die eigene Arbeit zu erhalten. Dadurch werden sie nicht nur besser für mögliche Gefährdungen sensibilisiert, sie erhalten auch Input, durch den sie besser vorbereitet in Gespräche mit Betriebsärztinnen und -ärzten gehen und die Zeit dort effizienter zu nutzen können. Um den BAKI-AI-Algorithmus zu trainieren, wird ein umfangreicher Datensatz von virtuellen Beschäftigten in Deutschland erhoben. Dafür werden Mitarbeitende aus diversen Partnerunternehmen und Universitäten rekrutiert. Die Datenerhebung erfolgt multimodal. Es werden neben Fragebögen diverse Sensoren wie Smartwatches, Raumsensoren und eine Applikation verwendet. Dies ermöglicht es, eine große Bandbreite an psychologischen, physiologischen und umgebungsbezogenen Faktoren zu erheben, ohne die Arbeit der Teilnehmenden zu stören. Dabei werden neben vielen weiteren Faktoren zum Beispiel die Herzratenvariabilität, Luftqualität und Frequenz der Mausklicks erfasst. Mit Hilfe der Sensoren wird die Erhebung über mehrere Wochen durchgeführt, wobei nur an Tagen erhoben wird, an denen die Teilnehmenden von zuhause oder anderen virtuellen Arbeitsplätzen aus arbeiten. Für die Auswahl an Konstrukten für die Datenerhebung wurde ein Scoping Review durchgeführt. Dieses erfasste Ressourcen, Anforderungen und Umgebungsfaktoren, die einen Einfluss auf die Gesundheit von virtuellen Beschäftigten haben, und sichert eine literaturbasierte Basis für die Datenerhebung.
BAKI-social wird als virtuelle Interaktionsplattform entwickelt, die die Kommunikation zwischen Betriebsärztinnen und-ärzten sowie virtuell Beschäftigten verbessern soll. Dabei werden innovative Ansätze der erweiterten und virtuellen Realität (XR-Technologien) kombiniert, um eine benutzerfreundliche und immersive virtuelle Umgebung zu erstellen. Als technologische Grundlage für das System fungiert der XR-Hub der Universität Würzburg. Dieser bietet neben 3D-Trackingsystemen zur Ansteuerung unterschiedlichster Avatare eine sichere Infrastruktur für die soziale Interaktion in VR (Virtual Reality). Die detaillierte Konzeptualisierung von BAKI-social wurde bewusst offengehalten. Im Zuge des Projekts werden diverse Prototypen entwickelt und gemeinsam mit Betriebsärztinnen und -ärzten sowie Schauspielpatientinnen und -patienten evaluiert und miteinander verglichen. Damit wird eine benutzerzentrierte und praxisnahe Entwicklung garantiert, so dass das finale System nahtlos im betrieblichen Gebrauch eingesetzt werden kann.
Andere Arbeitspakete, die auf die Öffentlichkeitsarbeit und die Nachwuchsförderung abzielen, laufen während der gesamten Projektlaufzeit mit. Diese inkludieren Publikationen, Veröffentlichungen und die Teilnahme an Konferenzen, um die Erkenntnisse des Projekts nach außen zu tragen. Für die Nachwuchsförderung werden an der Universitätsmedizin Göttingen und der Universität Würzburg interdisziplinäre Lehrmodule konzipiert. Diese sollen den Studierenden neue Kompetenzen nahebringen und Interesse an interdisziplinärer Forschung wecken, so dass eine neue Generation an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Themen Technologie und Gesundheit begeistert werden.
Erste Ergebnisse
In dem Scoping Review, das als Basis für die Datenerhebung von BAKI-AI dient, wurden Ressourcen, Anforderungen und Umgebungsfaktoren identifiziert, die die mentale und/oder physische Gesundheit von virtuell Beschäftigten beeinflussen. In dem Review wurden 207 Ressourcen, 177 Anforderungen und 71 Umgebungsfaktoren aus 80 Publikationen extrahiert. Die extrahierten Konstrukte werden als Grundlage für die Fragebogenerstellung und die Auswahl der Variablen, die mit den Sensoren erhoben werden, verwendet. Die Ergebnisse des Reviews zeichnen ein differenziertes Bild von virtueller Arbeit, das viele positive Aspekte aufzeigt, wie zum Beispiel erhöhte Autonomie und bessere Lebensgestaltung, aber auch negative Effekte wie erhöhten Zeitdruck und Vereinsamung.
Diskussion und Ausblick
BAKI nutzt innovative Vorgehensweisen, um neue Tools und Ergebnisse zu produzieren. Im Zentrum des Projekts stehen zwei neue Tools, die entwickelt werden, ein lernendes System und eine XR-Umgebung. Während diese innovativen Technologien viele neue Möglichkeiten bieten, gibt es auch einige kritische Punkte, die während der Entwicklung und der späteren Implementation berücksichtigt werden müssen.
BAKI-AI ist als lernendes System konzipiert, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse auch in der Zukunft relevant sind. Zusätzlich soll das System die vorliegende große, multimodale Datenmenge effizient auswerten und Korrelationen finden, die von traditionellen Methoden übersehen werden. Die Verwendung eines lernenden Systems bringt allerdings auch neue Herausforderungen mit sich. Datenschutz ist häufig ein kritischer Aspekt in der Entwicklung von lernenden Algorithmen. Um sicherzustellen, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind, ist der Einsatz von sogenanntem „Federated Learning“2 geplant und außerdem wurde ein detailliertes Datenschutzkonzept ausgearbeitet. Dafür wird auch eine Person aus dem Berlin Ethics Lab der TU-Berlin einbezogen, um sicherzustellen, dass alle ethischen Aspekte in der Entwicklung des Systems berücksichtigt werden. Des Weiteren gibt es viele verschiedene Herangehensweisen und Methodologien, was die Auswahl des Algorithmus angeht. Hier werden verschiedene Algorithmen getestet, um die beste Lösung zu finden.
Technologien der erweiterten Realität bieten innovative Lösungen, um digitale Kommunikation zu verbessern und mit mehr Tiefgang zu gestalten (Segal et al. 2011). Auch im Bereich der Medizin wurden die Möglichkeiten dieser Technologien bereits erforscht, wo sie unter anderem für verbesserte Visualisierungen und Untersuchungen von örtlich verteilen Patientinnen und Patienten verwendet werden können (Vincze et al. 2023; Morimoto et al. 2022). Allerdings gibt es hier besonders im Bereich der Arbeitsmedizin immer noch Bedarf für weitere Erkenntnisse. Um dies voranzutreiben, setzt BAKI auf innovative und benutzerzentrierte Lösungen. Für die Implementierung in der Praxis gibt es allerdings immer noch Hindernisse, die beachtet werden müssen. So sind XR-Technologien immer noch relativ teuer, was ihre breite Anwendung erschwert. Des Weiteren ist das Maß an Präsenz oder wie sich Personen „vor Ort“ in virtuellen Umgebungen fühlen ein wichtiger Aspekt für die Effektivität des Systems (Schuemie et al. 2001). Motion Sickness und ähnliche Probleme müssen ebenfalls beachtet werden, um eine benutzerfreundliche Umgebung zu entwickeln (Chang et al. 2020).
Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.
Literatur
Bretschneider M, Drössler S, Magister S, Zeiser M, Kämpf D, Seidler A: Digitalisierung und Psyche – Rahmenbedingungen für eine gesunde Arbeitswelt. Ergebnisse des Projektes GAP. Z Arb Wiss 2020; 74: 63–75. DOI: 10.1007/s41449-020-00206-x (Open Access).
Chang E, Kim HT, Yoo B: Virtual reality sickness: a review of causes and measurements. Int J Hum Comput Interact 2020; 36: 1658–1682. DOI: 10.1080/10447318.2020.1778351 (Open Access).
Hossain L, Wigand RT: ICT Enabled virtual collaboration through trust. J Comput Mediat Commun 2004; 10: 22. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2004.tb00233.x.
Marx J, Stieglitz S, Brünker F, Mirbabaie M: Home (office) is where your heart is. Bus Inf Syst Eng 2023; 65: 293–308. DOI: 10.1007/s12599-023-00807-w (Open Access).
Morimoto T, Kobayashi T, Hirata H et al.: XR (Extended Reality: Virtual reality, augmented reality, mixed reality) technology in spine medicine: status quo and quo vadis. J Clin Med 2022; 11 (2). DOI: 10.3390/jcm11020470 (Open Access).
Orlikowski WJ, Scott SV: Digital work: A research agenda. A Research Agenda for Management and Organization Studies 2016; 8: 88–95.
Schuemie MJ, van der Straaten P, Krijn M, van der Mast CA: Research on presence in virtual reality: a survey. Cyberpsychol Behav 2001; 4: 183–201. DOI: 10.1089/109493101300117884.
Segal R, Bhatia M, Drapeau M: Therapists’ perception of benefits and costs of using virtual reality treatments. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2011; 14: 29–34. DOI: 10.1089/cyber.2009.0398 (Open Access).
VII. Technischer und organisatorischer Arbeitsschutz in der digitalisierten Arbeitswelt: In: Tisch A, Wischniewski S (Hrsg.): Sicherheit und Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt: Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 273–312.
Vincze M, Molnar B, Kozlovszky M: 3D visualization in digital medicine using xr technology. Future Internet 2023; 15: 284. DOI: 10.3390/fi15090284 (Open Access).
Wütschert MS, Romano-Pereira D, Suter L, Schulze H, Elfering A: A systematic review of working conditions and occupational health in home office. Work 2022; 72: 839–852. DOI: 10.3233/WOR-205239 (Open Access).
Kontakt
Felix Leitner
Institut für Arbeits-, Sozial- und Präventivmedizin
Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität
Waldweg 37 B
‚37073 Göttingen
felix.leitner@med.uni-goettingen.de