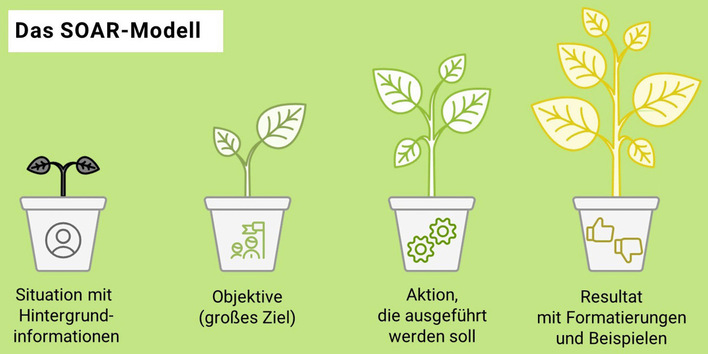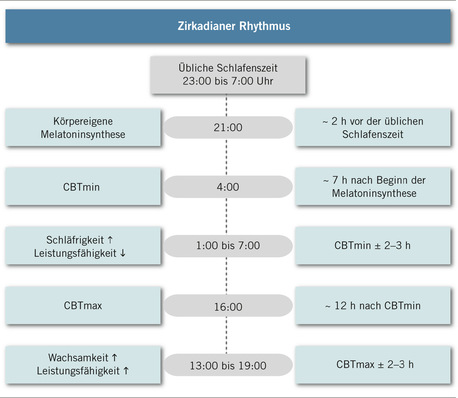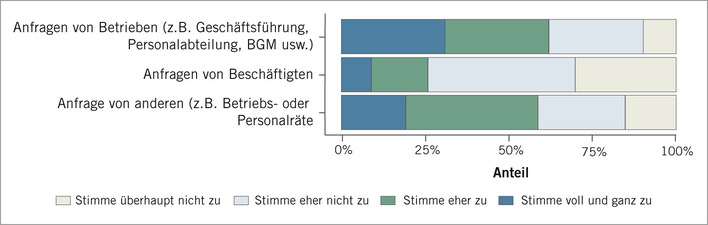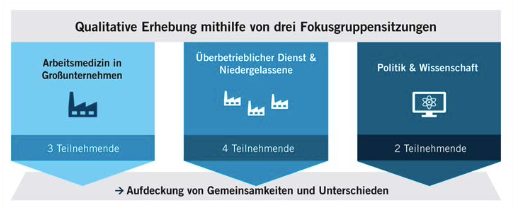Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Hepatitis B infection as an occupational disease among firefighters1
Taking into account the nature of the working environment, other insured persons may also be exposed to a risk of infection to a similar extent as employees in the health service, welfare services or in a laboratory. If the nature of the insured activity entails such a risk situation, the possibility that the respective infection may have occurred as a result of the specific activities performed is sufficient for the determination of BK 3101. This decision specifies when a particularly increased risk of infection for other occupational groups can be assumed.
Kernaussagen
Hepatitis-B-Infektion als Berufskrankheit bei Feuerwehrleuten1
Unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Arbeitsumfelds können auch andere Versicherte in ähnlichem Maße wie Beschäftigte im Gesundheitsdienst, der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium einer Infektionsgefahr ausgesetzt sein. Im Falle einer versicherten Tätigkeit, die naturgemäß mit solchen Gefahren verbunden ist, ist für die Anerkennung einer BK 3101 die Möglichkeit einer Infektion aufgrund der ausgeübten Tätigkeit ausreichend. Die vorliegende Entscheidung konkretisiert, wann von einer besonders erhöhten Infektionsgefahr für andere Berufsgruppen auszugehen ist.
Tatbestand
Die Beteiligten streiten über die Feststellung einer Berufskrankheit nach Nr. 3101 (BK 3101) der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) „Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war“.
Der 1969 geborene Kläger war von 2013 bis 2018 Mitglied, Wehrführer und Bergretter der Freiwilligen Feuerwehr. Neben klassischen Lösch- und Hilfetätigkeiten versorgte er Verkehrsunfallverletzte und im Bereich
der Bergrettung Personen, die in unwegsamem Gelände bei Wanderungen, Kletteraktionen oder beim Gleitschirmfliegen verunglückt waren. Diese Unfallopfer transportierte er auf Tragen und sicherte sie teilweise unmittelbar am eigenen Körper, wobei es zu Kontakt mit Blut und sonstigen Körperflüssigkeiten kommen konnte. Im Oktober 2017 wurde beim Kläger Hepatitis B diagnostiziert. Die Beklagte lehnte es ab, einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit festzustellen, weil der Kläger bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Freiwillige Feuerwehr während der Rettungs- und Bergungseinsätze keiner erhöhten Gefahr für eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus ausgesetzt gewesen sei.
Das Sozialgericht (SG) hatte eine BK 3101 festgestellt. Die erforderliche erhöhte Infektionsgefahr beruhe auf dem Übertragungsrisiko bei den ausgeübten Rettungstätigkeiten. Vor allem bei der Bergrettung habe der Kläger unvermeidbar Kontakt mit Blut und sonstigen Körperflüssigkeiten Dritter gehabt. Dieses Urteil war vom Landessozialgericht (LSG) aufgehoben worden, weil der Kläger tätigkeitsbedingt nicht in ähnlichem Maße infektionsgefährdet gewesen sei wie Personen im Gesundheitsdienst. Er habe in der Inkubationszeit nur drei Einsätze von insgesamt sechs mit infektionsrelevantem Personenkontakt gehabt und dabei in der Regel Schutzkleidung einschließlich Handschuhen getragen. Zudem fehle es an einem erhöhten Grad der Durchseuchung des Arbeitsumfelds.
Die zulässige Revision des Klägers war begründet. Der Kläger war gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit (i. V. m.) § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII unfallversichert, weil er nach den bindenden Feststellungen des LSG in einem Unternehmen zur Hilfe in Unglücksfällen, der Freiwilligen Feuerwehr, ehrenamtlich Personen aus Zwangslagen rettete und Abwasser in vollgelaufenen Kellern beseitigte. Er hatte mit der Hepatitis B eine Krankheit im Sinne der (i. S. d.) BK 3101.
Einwirkung im Sinne der BK 3101
Das Bundessozialgericht (BSG) betonte, für die Feststellung einer Einwirkung i. S. d. BK 3101 genüge eine besonders erhöhte Infektionsgefahr. Sie sei nicht Bestandteil eines Ursachenzusammenhangs zwischen versicherter Tätigkeit und einer Infektionskrankheit i. S. d. BK 3101, sondern ersetze als eigenständiges Tatbestandsmerkmal die Einwirkung. Deshalb müsse ein konkreter Kontakt mit einer infizierten Person oder kontaminiertem Material (z. B. Abwässern) nicht nachgewiesen sein. Stattdessen reiche es aus, dass der Versicherte einer der versicherten Tätigkeit innewohnenden besonderen Infektionsgefahr mit einer von Mensch zu Mensch übertragbaren Erkrankung ausgesetzt gewesen ist. Die erhöhte Infektionsgefahr sei mit dem weiteren Tatbestandsmerkmal „Verrichtung einer versicherten Tätigkeit“ durch einen wesentlichen Kausalzusammenhang, hingegen mit der Erkrankung nur durch die Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs verbunden. Sie müsse im Vollbeweis vorliegen.
Grad der Durchseuchung
Die besonders erhöhte Infektionsgefahr könne im Einzelfall auf der Durchseuchung des Umfelds der Tätigkeit oder der Übertragungsgefahr der ausgeübten Verrichtungen beruhen. Der Grad der Durchseuchung sei sowohl hinsichtlich der kontaktierten Personen als auch der Objekte festzustellen, mit oder an denen zu arbeiten ist. Lasse sich das Ausmaß der Durchseuchung nicht aufklären, könne aber das Vorliegen eines Krankheitserregers im Arbeitsumfeld nicht ausgeschlossen werden, sei vom Durchseuchungsgrad der Gesamtbevölkerung auszugehen.
Übertragungsgefahr
Das weitere Kriterium der mit der versicherten Tätigkeit verbundenen Übertragungsgefahr richte sich nach dem Übertragungsmodus der jeweiligen Infektionskrankheit sowie der Art, der Häufigkeit und der Dauer der vom Versicherten verrichteten gefährdenden Handlungen. Eine schlicht abstrakte Infektionsgefahr genüge nicht. Vielmehr werde eine (zum Teil typisierend nach Tätigkeitsbereichen) besonders erhöhte Infektionsgefahr vorausgesetzt. Deshalb komme es darauf an, welche einzelnen Verrichtungen im Hinblick auf den Übertragungsweg beziehungsweise -modus sowie ihrer Art, Häufigkeit und Dauer nach besonders infektionsgefährdend seien. Die Durchseuchung des Arbeitsumfelds auf der einen und die Übertragungsgefahr der versicherten Verrichtungen auf der anderen Seite stünden in einer Wechselbeziehung zueinander. An den Grad der Durchseuchung könnten umso niedrigere Anforderungen gestellt werden, je gefährdender die spezifischen Arbeitsbedingungen sind. Je weniger hingegen die Arbeitsvorgänge mit dem Risiko der Infektion behaftet seien, umso mehr erlange das Ausmaß der Durchseuchung an Bedeutung. Erscheine eine Infektion nicht ausgeschlossen, sei im Wege einer Gesamtbetrachtung der Durchseuchung und der Übertragungsgefahr festzustellen, ob sich im Einzelfall eine Infektionsgefahr ergebe, die nicht nur geringfügig gegenüber der Allgemeingefahr erhöht sei.
Abstrakte Gefährdung
Der Kläger habe seine versicherte Ehrenamtstätigkeit als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr nicht im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium ausgeübt. Entscheidend sei daher, ob er im Sinne der 4. Alternative der BK 3101 „durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße“ besonders ausgesetzt war. Insoweit sei nicht abstrakt auf die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr abzustellen und für diesen Personenkreis ein generell erhöhtes Infektionsrisiko zu verlangen, ohne die vom Versicherten konkret verrichteten Tätigkeiten zu berücksichtigen. Bei der BK 3101 sei vielmehr festzustellen, ob dem versicherten Tätigkeitsbereich eine abstrakte Gefährdung innewohnt und sich die generelle Gefahr aufgrund der im Gefahrenbereich individuell vorgenommenen Verrichtungen auch tatsächlich realisiert haben kann. Sei unter Berücksichtigung der Art der versicherten Tätigkeit und der Beschaffenheit des Tätigkeitsumfelds eine generelle Gefährdung nicht denkbar, scheidet die BK 3101 schon deshalb aus. Liege hingegen eine mit der versicherten Tätigkeit verbundene abstrakte Gefährdung vor, komme es darüber hinaus darauf an, ob der Versicherte infolge seiner konkret ausgeübten Verrichtungen einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt war, die sich dann nach der Durchseuchung des Tätigkeitsumfelds sowie der Übertragungsgefahr richte. Insoweit sei zunächst entscheidend, ob die im Rahmen der versicherten Tätigkeit verrichteten Arbeiten ihrer Art nach unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Arbeitsumfelds mit einer abstrakten Gefahrenlage einhergehen.
Abstrakte Infektionsgefahren hätten bei der Abwasserbeseitigung aus Kellern und insbesondere beim Versorgen, Sichern und Transportieren von Verletzten aus unwegsamem Gelände vorgelegen. Dies entnehme der Senat der Zusammenstellung der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Kurzgutachten des Sachverständigen D, deren Inhalte sich das LSG durch ausdrückliche Bezugnahmen in dem angefochtenen Urteil jeweils komplett zu eigen gemacht habe. Nach dem Sachverständigengutachten sei das Risiko der Übertragung des Hepatitis-C-Virus signifikant erhöht, wenn – auch durch Mikrotraumata – verletzte Haut mit kontaminiertem Blut und anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt komme. Beschäftigte mit potenziellen Blutkontakten hätten ein 2,7fach erhöhtes Risiko für eine Hepatitis-C-Erkrankung. Der Sachverständige habe auch ausgeführt, dass wegen desselben Übertragungswegs der Virenstämme diese Erkenntnisse auf das Hepatitis-B-Virus übertragbar sind. Mitarbeitende im Rettungsdienst seien noch stärker gefährdet. Denn aufgrund von Mikrotraumata beim Bergen und Retten Verletzter steige die Wahrscheinlichkeit der Übertragung kontaminierter Körpersekrete auf die ungeschützte, nicht intakte Haut. Nach den bindenden Feststellungen des LSG habe sich der Kläger insbesondere bei der Bergrettung in dieser besonderen Gefahrensituation befunden, weil er in unwegsamem Gelände Verunglückte auf Tragen transportieren und teilweise unmittelbar am eigenen Körper sichern musste, wobei es unvermeidbar zu Kontakt mit potenziell infektiösen Körperflüssigkeiten Blut, Schweiß, Tränen sowie mit Erbrochenem kommen konnte.
Realisierung der Gefahr
Ausgehend von dieser abstrakten Gefahrenlage sei der Kläger als Wehrführer und Bergretter bei der Freiwilligen Feuerwehr einem besonders erhöhten Infektionsrisiko konkret-individuell ausgesetzt gewesen, obgleich die Durchseuchung in seinem Tätigkeitsbereich nicht erhöht war. Denn die Verrichtungen des Klägers im Rahmen seiner versicherten Tätigkeit seien im Hinblick auf den Übertragungsmodus der Hepatitis-B-Infektion sowie ihrer Art, Häufigkeit und Dauer besonders infektionsgefährdend, so dass sich im Wege der erforderlichen Gesamtbetrachtung von Durchseuchung und Übertragungsgefahr eine Infektionsgefahr ergebe, die nicht nur geringfügig erhöht sei. Der Nachweis einer konkreten tätigkeitsbedingten Infizierung sei dagegen entbehrlich.
Das Berufungsgericht habe zwar nicht die Möglichkeit der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus, aber eine erhöhte Durchseuchung des Umfelds der Feuerwehreinsätze ausgeschlossen. Damit sei der Grad der Durchseuchung in der Gesamtbevölkerung maßgebend, der 0,3 v. H. beträgt (Robert Koch-Institut 2022, S. 5; Dudareva et al. 2022, S. 149, 153). Nach den unangegriffenen und damit bindenden Feststellungen des LSG sei die Tätigkeit bei der Feuerwehr, auch im Bereich der Bergrettung, nicht dadurch gekennzeichnet, dass mit und an kranken Menschen gearbeitet werde. Weder für verunglückte Kletterer, Wanderer oder Gleitschirmflieger noch für sonstige Unfallopfer sei nachgewiesen, dass sie häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung mit Hepatitis B infiziert sind. Studien zum Infektionsrisiko bei Rettungseinsätzen der Feuerwehr in Deutschland existierten nicht, wie dem Sachverständigengutachten zu entnehmen ist. Daher sei für die Annahme eines deutlich überdurchschnittlichen Durchseuchungsgrades im Tätigkeitsfeld der Feuerwehr kein Raum.
Die besondere Infektionsgefahr beruhe hier indes auf der Übertragungsgefahr in Gestalt einer hohen Infektiosität (Ansteckungsfähigkeit) des Hepatitis-B-Virus bei minimaler Infektionsdosis und den intensiven, das heißt zeitlich längeren und körperlich engen Kontakten des Klägers im unmittelbaren Nahfeld der verunglückten Personen, wobei seine Hautbarriere durch einsatzbedingte Mikrotraumata der ungeschützten Hautbereiche typischerweise geschwächt gewesen sei und dem Hepatitis-B-Virus entsprechende Eintrittspforten bot. Die Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus erfolge parenteral („am Darm vorbei“) durch infektiöses Blut und andere Körperflüssigkeiten. Dies geschehe häufig bei Nadelstichverletzungen, aber auch, wenn Körperflüssigkeiten auf – zum Beispiel durch Mikrotraumata – verletzte Haut treffen. Denn zur Übertragung des Hepatitis-B-Virus müsse ein direkter Kontakt der infektiösen Viruspartikel mit dem Blutsystem des Empfängers stattfinden, wobei kleinste Verletzungen bei direktem Kontakt von virushaltigem Material mit der Haut oder Schleimhaut genügten. Das Infektionsrisiko sei dann nicht geringer als bei Nadelstichverletzungen, wie aus dem Sachverständigengutachten hervorgehe, auf das die Vorinstanz ausdrücklich Bezug genommen habe.
Unter Berücksichtigung der hohen Übertragungsfähigkeit des Krankheitserregers, des aufgezeigten Übertragungswegs und der Inkubationszeit einer Hepatitis-B-Erkrankung habe das LSG zur tatsächlichen Infektionsgefahr und möglichen Einwirkungsereignissen auf das Jahr 2017 mit sechs Einsätzen des Klägers abgestellt. Dabei erfolgten nach den bindenden Feststellungen des LSG drei Einsätze mit Personenkontakt und dem Risiko einer Virusübertragung. Da bei der Hepatitis-B-Infektion bereits unsichtbar kleinste Mengen infektiösen Bluts zu einer Übertragung führen könnte, schon ein einmaliger unmittelbarer Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei geschwächter Hautbarriere ausreiche und für Personen, die im Berufsleben regelmäßig Kontakt mit potenziell infektiösem Material (wie Blut oder anderen Körpersekreten) hätten, ein erhöhtes berufsbedingtes Risiko für die Übertragung von Hepatitis B bestehe, liege für die Tätigkeit des Klägers eine konkret erhöhte Infektionsgefahr vor.
Gesamtbetrachtung
Die Gesamtbetrachtung der niedrigen Durchseuchung einerseits und der erhöhten Übertragungsgefahr andererseits ergebe für den Kläger eine Infektionsgefahr, die nicht nur geringfügig erhöht sei. Komme – wie hier – eine Infektion in Betracht, sei im Wege einer Gesamtbetrachtung der Durchseuchung und der Übertragungsgefahr festzustellen, ob sich im Einzelfall eine Infektionsgefahr ergebe, die nicht nur geringfügig erhöht sei, sondern in besonderem Maße über der Infektionsgefahr in der Gesamtbevölkerung liege. Entscheidend sei immer die Gesamtwürdigung der das Arbeitsumfeld und die versicherte Tätigkeit betreffenden beiden Risikobereiche unter Berücksichtigung des spezifischen Übertragungsmodus und Verbreitungsgrades der jeweiligen Infektionskrankheit.
In seiner Argumentation komme das LSG zu dem Schluss, der Kläger sei nicht in ähnlichem Maße einer konkreten Infektionsgefahr, vergleichbar den im Gesundheitsdienst Tätigen, ausgesetzt gewesen. Dieses Ergebnis stützt es maßgeblich auf die vorhandene Schutzausrüstung, einen erheblichen Anteil von Einsätzen ohne Personenkontakt und vor allem auf die geringe Anzahl der zu erwartenden Kontakte mit dem Hepatitis-B-Virus. Insoweit sei keine Vergleichbarkeit mit den im Gesundheitsdienst Tätigen gegeben. Dabei lasse die Vorinstanz indes unbeachtet, dass die Frage, ob der Kläger – wie zum Beispiel Beschäftigte im Gesundheitsdienst – einer „Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt“ war, vorliegend schon mit der abstrakten Gefahrenlage bejaht wurde. Die im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigende besonders erhöhte Infektionsgefahr ergebe sich hingegen aus einem Vergleich mit der Gefahr, die in der Bevölkerung allgemein hinsichtlich einer Infektion bestehe. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei einer Rettungsmaßnahme gering sei, komme eine tätigkeitsbedingte besonders erhöhte Infektionsgefahr in Betracht, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion in der Allgemeinbevölkerung noch geringer sei. Davon sei vorliegend auszugehen. So habe das LSG im Inkubationszeitraum drei Einsätze mit Kontakt zu verletzten Personen festgestellt, bei denen das Risiko einer entsprechenden Viruserkrankung bestand. Nach dem Sachverständigengutachten sei gerade aufgrund der Mikrotraumata der ungeschützten Haut beim Bergen und Retten in den Bergen von einem ähnlich hohem Infektionsrisiko mit dem Hepatitis-B-Virus auszugehen wie bei der Behandlung von Patienten im Krankenhaus, wo für Beschäftigte im Gesundheitsdienst ein 2,7fach erhöhtes Risiko für eine Hepatitis-B-Erkrankung bestehe. Damit bestehe für den Senat kein Zweifel, dass der Kläger konkret-individuell einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt war.
Dabei stehe – anders als das LSG meine – der Annahme eines besonderen Infektionsrisikos nicht entgegen, dass der Kläger in der Inkubationszeit nur in drei Einsätzen Kontakt zu verletzten Personen mit dem Risiko einer Viruserkrankung hatte. Denn eine konkrete Infektionssituation müsse nicht nachgewiesen sein, zumal sie auch in Vorgängen liegen könne, die weniger Beachtung erfahren, wie beispielsweise das Durchschreiten, Inspizieren und Abpumpen fäkalienbelasteter und damit potenziell durchseuchter Abwässer aus Kellern. Eine Hepatitis-B-Infektion könne bereits bei
einmaligem und geringfügigem Kontakt mit dem Krankheitserreger erfolgen. Schon deshalb stehe der zahlenmäßig geringe Kontakt des Klägers mit potenziell infizierten Personen der Annahme, er sei „der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt“ gewesen wie zum Beispiel Versicherte im Gesundheitsdienst, nicht entgegen.
Typisierte Kausalität
Liegen eine durch die versicherte Tätigkeit bedingte besonders erhöhte Infektionsgefahr und die Infektionskrankheit vor, nimmt der Verordnungsgeber typisierend an, dass die Infektion während und wegen der Gefahrenlage erfolgte und die Erkrankung wesentlich verursacht hat. Diese Typisierung gelte nur dann nicht, wenn ausgeschlossen sei, dass die Infektion während oder aufgrund der versicherten Tätigkeit eingetreten sein kann. Für einen Ursachenzusammenhang zwischen beruflich bedingter besonders erhöhter Infektionsgefahr und Krankheit sei zum Beispiel kein Raum, wenn die Infektion unter Berücksichtigung der Inkubationszeit nicht während der Dauer der beruflichen Gefahrenexposition erfolgt sein kann. Ein regelhafter Schluss von einer berufsbedingt erhöhten Infektionsgefahr auf eine berufliche Ursache der festgestellten Krankheit sei ferner nur gerechtfertigt, wenn neben der Gefährdung durch die versicherte Tätigkeit keine anderen, dem privaten Lebensbereich zuzuordnenden Infektionsrisiken bestanden hätten. Kämen sowohl berufliche als auch außerberufliche Verrichtungen als Infektionsquelle in Betracht, von denen aber nur eine allein die Krankheit ausgelöst haben kann, müsse entschieden werden, ob sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine der unter Versicherungsschutz stehenden Handlungen als Krankheitsursache identifizieren lasse. Dann verbleibe es insofern beim Beweismaßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Die tatsächlichen Voraussetzungen für das Vorliegen solcher außerberuflichen Umstände müssten im Vollbeweis nachgewiesen sein. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung trügen insoweit die objektive Beweislast.
Vorliegend sei die Kausalität zwischen der tätigkeitsbedingt erhöhten Infektionsgefahr, der Hepatitis-B-Infektion und der Infektionskrankheit nicht ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Inkubationszeit von 60 bis 180 Tagen trat die im Herbst 2017 festgestellte Hepatitis-B-Infektion im zeitlichen Zusammenhang mit den vom LSG festgestellten gefährdenden Tätigkeiten am 03.06.2017 (Abwasser im Keller), 06.06.2017 (Person mit Erbrechen und Durchfall) und 15.06.2017 (Ohnmacht mit Kaltschweiß) auf. Mangels anderweitiger Feststellungen des LSG hätten neben der berufsbedingten Infektionsgefahr keine anderen Infektionsrisiken bestanden, und es sei nicht ausgeschlossen, dass die vorgenannten gefährdenden Tätigkeiten zur Infektion geführt haben. Vielmehr habe das LSG zu den hier relevanten Einsätzen mit verunglückten Personen in Zwangslagen festgestellt, dass diese mit Personenkontakt erfolgten und bei ihnen das Risiko einer Virusübertragung bestand.
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.