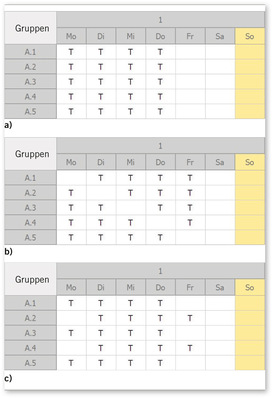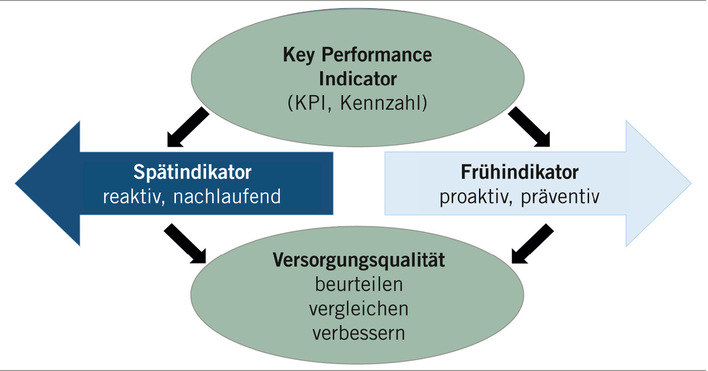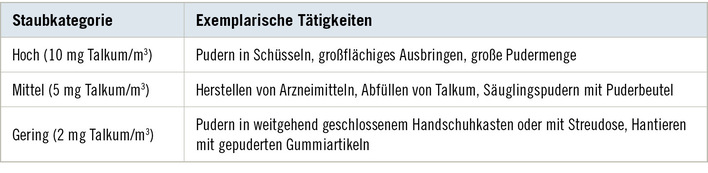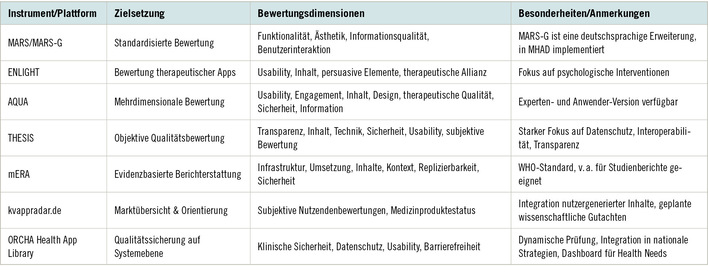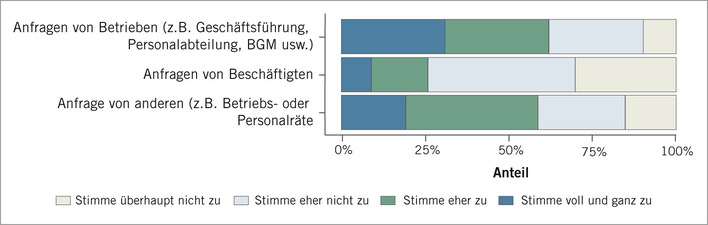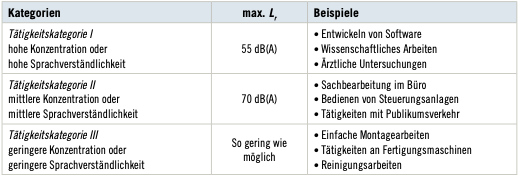Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
How Women Experience Health in Tyrol
The qualitative component of the Tyrolean Women’s Health Study provides insight into how women perceive and experience health. The interviews reveal service gaps, psychosocial burdens, and phase-of-life specific challenges. This article outlines practical entry points for gender-sensitive healthcare and the development of health-promoting structures.
Wie Frauen Gesundheit in Tirol erleben
Der qualitative Teil der Tiroler Frauengesundheitsstudie bietet Einblicke in subjektive Gesundheitswahrnehmungen von Frauen. Die Interviews beleuchten Versorgungslücken, psychosoziale Belastungen und Lebensphasenspezifika. Der Beitrag zeigt praxisnahe Anknüpfungspunkte für eine geschlechtersensible Versorgung und gesundheitsförderliche Strukturen.
Kernaussagen
Einleitung und Zielstellung
Grundlage für diesen Beitrag bildet der veröffentlichte Endbericht der zielgruppenspezifischen Befragung zur Frauengesundheit in Tirol (s. Online-Quelle).
Im Zuge des Bestrebens des Landes Tirol, die Gesundheitsversorgung von Frauen gezielter und wirksamer zu gestalten, wurde unter der Leitung der Abteilung Öffentliche Gesundheit (vormals Abteilung öffentlicher Gesundheitsdienst) eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung initiiert. Ziel dieser Erhebung war es, die gesundheitlichen Herausforderungen und Bedürfnisse von Frauen in Tirol in unterschiedlichen Lebensphasen systematisch zu erfassen. Bisher standen nur unzureichende Daten zur Verfügung, was eine gezielte Bedarfsermittlung und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen erschwerte.
Vor diesem Hintergrund wurde ein interdisziplinäres Forschungskonsortium aus Tiroler Bildungs- und Forschungseinrichtungen1 beauftragt, eine breit angelegte Befragung durchzuführen. Diese umfasste unter anderem die allgemeine und psychische Gesundheit, reproduktive Aspekte sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Ziel der Studie war es, nicht nur bestehende Wissenslücken zu schließen, sondern auch eine fundierte Basis für zukünftige Strategien und Maßnahmen zu schaffen, die die Gesundheitschancen von Frauen verbessern und eine bedarfsgerechte Versorgung ermöglichen.
Während die quantitative Befragung breite statistische Erkenntnisse liefert, bietet der qualitative Studienteil einen differenzierten Einblick in subjektive Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erwartungen von Frauen in Tirol. Dieser Beitrag fasst die Ergebnisse der qualitativen Interviewstudie zusammen, deren Ziel es war, Perspektiven sichtbar zu machen, die in standardisierten Fragebögen nicht oder nur unzureichend abgebildet werden können.
Studiendesign und methodischer Zugang
Zur Erhebung subjektiver Perspektiven auf Frauengesundheit wurde ein semi-strukturierter Interviewleitfaden entwickelt. Die thematische Auswahl basierte auf einer Literaturrecherche, Abstimmungen im interdisziplinären Forschungskonsortium und Erkenntnissen aus der Erstellung des quantitativen Fragebogens. Im Fokus standen die Bereiche Gesundheitsversorgung, -förderung, -prävention sowie frauenspezifische Informations- und Unterstützungsangebote. Der Leitfaden ermöglichte eine flexible Gesprächsführung mit Raum für individuelle Ergänzungen und wurde zusätzlich speziell für Jugendliche angepasst. Ein Prätest mit vier Personen diente der Optimierung hinsichtlich Verständlichkeit, Struktur und Interviewdauer.
Die Interviews wurden nach Freigabe der Studie durch die Ethikkommission innerhalb von zwei Monaten geführt. Um eine möglichst breite demografische Streuung zu erzielen, erfolgte die Rekrutierung über soziale Medien, Beratungsstellen und institutionelle Kanäle (z. B. Tirol Institut für Qualität im Gesundheitswesen, fh gesundheit, Land Tirol). Das Sample für die Interviews wurde gemäß qualitativem Stichprobenplan (Döring u. Bortz 2016) gebildet, wobei folgende soziodemografischen Kriterien herangezogen wurden: Alter (in Form von Altersgruppen), Region in Tirol (Bezirke) und höchste abgeschlossene Ausbildung. Eingeschlossen wurden ausschließlich Frauen mit ausreichenden Deutschkenntnissen, um sprachliche Verzerrungen und Einschränkungen in der Ausdrucksfähigkeit zu vermeiden.
Ziel war ein Sample, das möglichst viele relevante Merkmalskombinationen abbildet, um tiefgehende, aussagekräftige Einsichten zu gewinnen.
Die Interviews wurden KI-gestützt transkribiert und manuell überarbeitet. Die anschließende Auswertung erfolgte mit der Software MAXQDA anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022). Ziel war es, zentrale Aussagen systematisch thematisch zu codieren. Insgesamt wurden 1611 relevante Textstellen identifiziert, die in zehn Haupt- und 39 Unterkategorien gegliedert wurden. Diese Kategorien reichen von individuellen Gesundheitsstrategien und Ressourcenverfügbarkeit über Gesundheitskompetenz, Vorsorge und Zugang bis hin zu geschlechter- und soziodemografischen Unterschieden.
Insgesamt haben sich 108 Interessentinnen gemeldet. Nach Selektierung gemäß demografisch repräsentativen Kriterien (insbesondere Altersgruppe und Bezirk) wurden 34 Interviews geführt. So sind alle neun Tiroler Bezirke vertreten. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 14 und über 60 Jahre alt, wobei die größte Gruppe die 31- bis 45-Jährigen stellte. Die Bandbreite reicht von keinem Pflichtschulabschluss bis hin zum Hochschulabschluss. Besonders häufig vertreten waren Frauen mit akademischer Ausbildung und weiterführender Berufsausbildung.
Die Interviews wurden je nach Wunsch der Teilnehmerinnen persönlich, telefonisch oder online durchgeführt. Die Gesprächsdauer lag zwischen 15 und 62 Minuten, mit einem Durchschnitt von 26,5 Minuten. Die hohe Streuung bei Alter, Bildungsstand und Wohnort soll gewährleisten, dass unterschiedliche Lebenslagen und Perspektiven berücksichtigt werden können.
Kernergebnisse der Interviews
Vorab entwickelte Kategorien dienen als Grundlage für die Analyse und ermöglichen eine differenzierte Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen Erfahrungen und Bedürfnissen von Frauen in Tirol. Die Interviewergebnisse gewähren aufschlussreiche Einblicke in ihren Lebensalltag und geben wichtige Impulse für die Konzeption passgenauer Maßnahmen zur Stärkung der Frauengesundheit in Tirol.
Gesundheitsverhalten und Versorgungspraxis
Frauen zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative im Umgang mit Beschwerden, greifen auf Hausmittel zurück und koordinieren Arztbesuche flexibel, um sie mit beruflichen und familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Im Alltag dominiert der Druck, trotz Krankheit zu funktionieren. Herausforderungen bestehen vor allem bei Facharztzugängen, langen Wartezeiten, und räumlicher Erreichbarkeit – besonders im ländlichen Raum.
Familiäre und soziale Rollen
Familien- und Care-Arbeit beeinflussen die Gesundheitsvorsorge erheblich. Frauen stellen eigene Bedürfnisse oft zurück, übernehmen organisatorische Verantwortung und sind auf familiäre Unterstützung angewiesen. Soziale Netzwerke spielen eine wichtige Rolle für Austausch und emotionale Entlastung.
Der Spagat zwischen Erwerbstätigkeit und Care-Arbeit könnte die Bedeutung flexibler, gesundheitsförderlicher Arbeitszeitmodelle untermauern.
Gesundheitsthemen, Prävention und Förderung
Im Zentrum stehen psychische Gesundheit, frauenspezifische Themen (Menstruation, Reproduktion, Wechseljahre), ganzheitliches Wohlbefinden, Sport, Ernährung und Vorsorge. Es besteht Bedarf an niederschwelligen, familienfreundlichen und erschwinglichen Gesundheitsförderangeboten sowie an verstärkter Prävention.
Die häufig berichteten psychischen Belastungen und Erschöpfungszustände könnten die Notwendigkeit für den Ausbau arbeitsmedizinischer Prävention psychischer Erkrankungen aufzeigen. Dies wurde jedoch nicht explizit in den Interviews erwähnt.
Gesundheitskompetenz und Informationszugang
Informationen werden meist eigenständig über Internet, soziale Medien oder persönliche Kontakte gesucht. Es gibt große Wissensunterschiede – insbesondere zu frauenspezifischen Erkrankungen. Gewünscht werden mehr strukturierte, verständliche und mehrsprachige Angebote über verschiedene Kanäle.
Barrieren und Ungleichheiten
Erhebliche Unterschiede bestehen je nach Alter, Region, Bildung und Migrationshintergrund. Sprachbarrieren, finanzielle Belastungen, fehlende Versorgungskapazitäten und gesellschaftliche Rollenerwartungen erschweren den Zugang. Eine geschlechterspezifische Benachteiligung wird besonders in medizinischen Kontexten kritisiert.
Mehrere Frauen schildern Situationen, in denen ihre Beschwerden bagatellisiert wurden – mit dem Verweis auf „hormonelle Ursachen“ oder Stress. Dies führt zu Verzögerungen in Diagnostik und Therapie. Auch wird kritisiert, dass Ärztinnen und Ärzte oft nicht für die Lebensrealität von Frauen sensibilisiert seien.
Berichte über fehlende geschlechtersensible Kommunikation legen nahe, arbeitsmedizinische Vorsorgeangebote und betriebliche Schulungen gendersensibel zu gestalten.
Erwartungen an das Gesundheitssystem
Gewünscht werden bessere Erreichbarkeit, flexiblere Terminangebote, digitale Lösungen, regionale Gesundheitszentren, geschlechtersensible Kommunikation sowie Aufklärung durch Fachpersonal. Wichtig ist eine gleichwertige, diskriminierungsfreie und wohnortnahe Versorgung für alle Frauen.
Limitationen
Die Ergebnisse der qualitativen Erhebung geben wertvolle Einblicke in subjektive Erfahrungen mit Gesundheit und Versorgung, sind jedoch aufgrund der begrenzten Fallzahl und der Beschränkung auf Deutsch sprechende Teilnehmerinnen nur eingeschränkt übertragbar. Methodisch bedingte Verzerrungen durch Interviewführung, soziale Erwünschtheit oder Erinnerungslücken sind möglich.
Schlussfolgerung
Die qualitativen Erkenntnisse zeichnen das Bild einer Gesundheitsversorgung, die vielfach als funktional, aber nicht ausreichend individuell oder geschlechtersensibel erlebt wird. Frauen wünschen sich insbesondere mehr niederschwellige Informations- und Unterstützungsangebote, kürzere Wartezeiten und mehr Zeit für Gespräche sowie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihren spezifischen gesundheitlichen Lebensrealitäten.
Diese Befunde liefern eine bedeutungsvolle Grundlage für gesundheitspolitische Maßnahmen, die über rein strukturelle Reformen hinausgehen: Gesundheit muss geschlechtssensibel gedacht und gestaltet werden – mit Blick auf Lebenskontext, Belastung durch Care-Arbeit und psychosozialen Ressourcen.
Interessenskonflikt: Das Autorenteam erklärt, dass das Forschungskonsortium aus Tiroler Bildungs- und Forschungseinrichtungen ein Honorar vom Land Tirol für die wissenschaftliche Untersuchung erhalten hat.
Ethikvotum: Das RCSEQ (Research Committee for Scientific Ethical Questions) prüfte als freiwillige Ethikkommission der UMIT TIROL und fhg das vorliegende Forschungsvorhaben in einer Gremiumssitzung am 29. Mai 2024 und erteilte dem Projekt am 18. Juni 2024 ein positives Votum für die Durchführung (3412/2024).
Literatur
Döring N, Bortz J: Forschungsmethoden und Evaluation: in den Sozial- und Humanwissenschaften. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016.
Jabinger E, Kerschbaumer L, Flatscher-Thöni M, Bernard G, Bogodistov Y, Davidsen S, Fouda A, Rogoll L, Schusterschitz C: Zielgruppenspezifische Befragung zur Frauengesundheit in Tirol. Endbericht, November 2024. https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesundheit-vorsorge/lds-sanita… FG_UMIT_FHG_MCI_NOV2024.pdf (abgerufen am 03.06.2025).
Kuckartz U, Rädiker S: Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden. 5. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, 2022.
Online-Quelle
Zielgruppenspezifische Befragung zur Frauengesundheit in Tirol. Endbericht, November 2024
www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesundheit-vorsorge/lds-sanitaetsdirek…
Koautor und Koautorin
Gilles Bernard, M.A. BSc.
Prof. in (FH) Eva Maria Jabinger, M.B.A. MSc. MSc. BSc.
Tirol Institut für Qualität im Gesundheitswesen
fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, Innsbruck