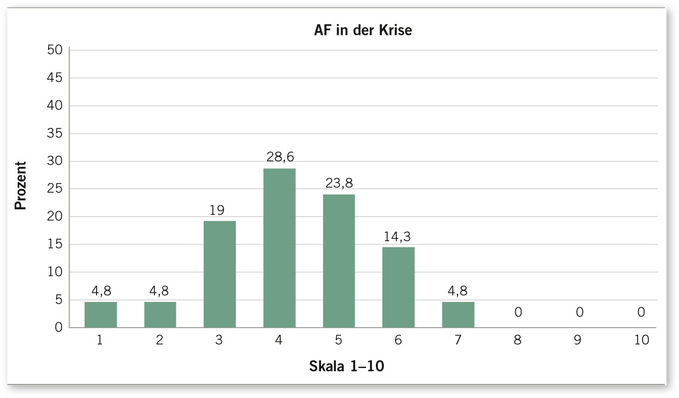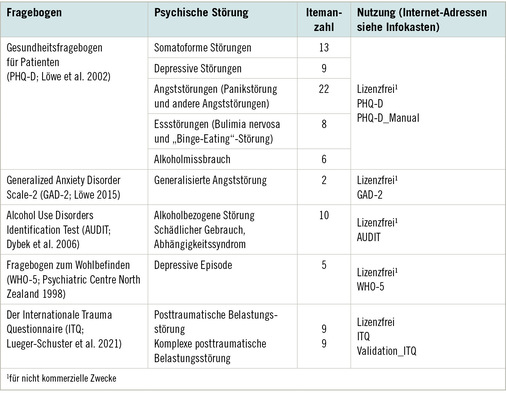Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
Revision of the Compact Procedure Psychological Burden for risk assessment of mental workload
Employers in Germany have to carry out an assessment of workplaces with regard to potential hazards for employees including mental stress factors. There exist various options for the operational procedure, each with its own advantages and disadvantages depending on the method used. The Compact Procedure Psychological Burden is a condition related instrument that allows users in particular to identify factors of mental workload in the workplace, assess the resulting hazards in terms of stress and strain and derive appropriate occupational health and safety measures. The procedure, which is designed as an observational interview, allows the user to use examples and design tips for a phased approach with prioritization options for the measures to be implemented. Current research findings and the state of the art as described in DIN EN ISO 10075-2:2023 were taken into account in the further development of the Compact Procedure Psychological Burden in 2024.
Überarbeitung des „Kompaktverfahrens Psychische Belastung“ für die Gefährdungsbeurteilung
Arbeitgeber in Deutschland müssen im Rahmen der sogenannten Gefährdungsbeurteilung auch Gefährdungen durch psychische Belastungsfaktoren berücksichtigen, wobei der Gesetzgeber dem Arbeitgeber keine Methoden und Verfahren vorschreibt. Daher existieren unterschiedliche Möglichkeiten mit den jeweils methodenabhängigen Vor- und Nachteilen. Mit dem Kompaktverfahren Psychische Belastung (KPB) steht ein bedingungs- und tätigkeitsbezogenes Instrument zur Verfügung, mit dem vor allem betriebliche Praktiker psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz erheben, die daraus resultierende Gefährdungen beanspruchungsbezogen bewerten und entsprechende Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ableiten können. Das als Beobachtungsinterview konzipierte Vorgehen erlaubt den Anwendenden mit Beispielen und Gestaltungshinweisen eine gestufte Vorgehensweise mit Priorisierungsmöglichkeiten der umzusetzenden Maßnahmen. Bei der Weiterentwicklung des KPB im Jahr 2024 wurden unter anderem aktuelle Forschungsergebnisse sowie der in DIN EN ISO 10075-2:2023 beschriebene Stand der Technik berücksichtigt.
Kernaussagen
Gesetzlicher und normativer Rahmen
Bereits im Jahr 2013 erfolgte eine Erweiterung des § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), wonach auch sogenannte psychische Belastungen bei der Arbeit als Quelle möglicher Gefährdungen bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen sind. Wenngleich das Thema im eigentlichen Sinne auch im Gesetz- und Verordnungswerk nichts Neues sein sollte (sic: Bildschirmarbeitsplatzverordnung von 1996), erfolgten seitdem Bestrebungen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) und weiterer interessierter Kreise, das Thema psychische Belastung auf unterschiedlichen Wegen in die Unternehmen zu tragen. Nach DIN EN ISO 10075-1:2018 ist psychische Belastung konzeptuell als Gesamtheit der psychisch auf Menschen einwirkenden Einflüsse zu verstehen, die auch erfassbar sein müssen. Diese können sich ergeben aus der Arbeitstätigkeit selbst, den Arbeits- und Umgebungsbedingungen, sozialen und organisationalen sowie auch gesellschaftlichen Faktoren, wobei bei Letzteren die Einflussmöglichkeit der Gestaltung seitens des Arbeitgebers eher gering ausfallen dürften. Die psychische Beanspruchung ist die unmittelbare Reaktion auf die Belastung und ist normativ – ebenso wie die Belastung – als neutral zu verstehen. Die je nach Art, Höhe und Dauer der vorausgegangenen Belastung und in Abhängigkeit individueller Eigenschaften resultierende Beanspruchung kann zu unterschiedlichen – förderlichen wie andererseits beeinträchtigenden – Folgen führen. Letztere sind durch eine adäquate und im besten Sinn vorausschauende Arbeitsgestaltung zu vermeiden. Kurzfristige beeinträchtigende Folgen sind nach Norm die psychische Ermüdung und ermüdungsähnliche Zustände wie Monotonie und herabgesetzte Vigilanz. Psychische Sättigung ist eine beeinträchtigende Folge mit gesteigerter Aktiviertheit und negativen Emotionen. Die Stressreaktion ist ebenfalls zu nennen. Grundsätzlich sind diese Folgen reversibel. Als langfristige Folge mit beeinträchtigendem Potenzial wird das Burnout gesehen, das in der aktuellen ICD-11 auch als arbeitsbezogene Folge mit den Dimensionen subjektiv erlebter emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation – als Distanzierung beziehungsweise Zynismus gegenüber der Arbeit – sowie reduzierter persönliche Leistungsfähigkeit bei der Arbeit klassifiziert wird.
Positive Folgen psychischer Belastung und Beanspruchung auf der anderen Seite umfassen Erlebniszustände wie Aktiviertheit, Aufwärmeffekte, Übung und Lernen, langfristig kann zum Beispiel auch von Kompetenzentwicklung gesprochen werden. In der arbeitspsychologischen Literatur werden auch positive Auswirkungen auf Motivation und Arbeitszufriedenheit erwähnt, die allerdings aufgrund der hohen interindividuellen Streuung keinen Eingang in die Norm DIN EN ISO 10075-1:2018 gefunden haben.
Mit dem Kompaktverfahren Psychische Belastung (KPB) steht ein bedingungs- und tätigkeitsbezogenes Instrument zur Verfügung, das es Anwendenden erlaubt, psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz zu erheben, die daraus resultierenden Gefährdungen beanspruchungsbezogen zu bewerten und entsprechende Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abzuleiten. Das Beobachtungsinterview sieht eine gestufte Vorgehensweise mit Priorisierungsmöglichkeiten der umzusetzenden Maßnahmen vor.
Entwicklung und Inhalte des KPB
Um Unternehmen beziehungsweise betriebliche Praktikerinnen und Praktiker bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen, hat das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. bereits 2005 das Kurzverfahren Psychische Belastung (KPB) entwickelt (s. Sandrock 2018). Das KPB orientiert sich konzeptuell an den Begrifflichkeiten und Konzepten des Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts von Rohmert (1984) und damit unter anderem an der DIN EN ISO 10075 Reihe.
Die Idee war, Anwendenden ein orientierendes Erhebungsverfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem ohne vertiefende Spezialkenntnisse Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit beurteilt werden können. Über die Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis und über die Verfahrensentwicklung wurde bereits in der Vergangenheit berichtet (vgl. Hofmann et al. 2018; Stahn u. Sandrock 2018; Sandrock 2019). Das in der Version von 2005 vorliegende Instrument wurde 2017 dahingehend überarbeitet, dass die ursprünglich verschiedenen Beanspruchungsfolgen zugeordneten Items nunmehr den Gestaltungsdimensionen beziehungsweise Merkmalsbereichen zugeordnet worden waren, die sich vergleichbar zum Beispiel in den in DIN EN ISO 10075:1-2018 dargestellten Facetten finden (Sandrock u. Stahn 2017).
Im Arbeitsprogramm „Psyche“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie wurde bereits im Jahr 2015 eine Merkmalsliste mit kritischen Belastungsfaktoren veröffentlicht, die zunächst in einer Leitlinie für Aufsichtsbehörden und schließlich auch in der bereits oben erwähnten Handlungshilfe Einzug hielten.
Dabei handelte es sich um die fünf Bereiche:
In der derzeit aktuellen Version dieser Handlungshilfe (GDA; Beck et al. 2022) gingen die „neuen Arbeitsformen“ in die übrigen Bereiche auf, da erstens die Verbreitung der neuen Arbeitsformen nicht mehr neu ist und zweitens auch bei diesen, zum Beispiel bei mobiler Arbeit, auf die Einhaltung arbeitswissenschaftlicher und arbeitsmedizinischer Kriterien zu achten ist, die bereits in diversen Regelwerken beschrieben sind. Während in der Version 2022 das Thema Arbeitszeit einen eigenen Gestaltungsbereich darstellt, wurde dies in der hier vorgestellten weiteren Anpassung des KPB nicht übernommen, da auch in DIN EN ISO 10075-2:2024 beschriebenen üblichen ergonomischen Konventionen die Arbeitszeit der Arbeitsorganisation zuzuordnen ist.
Nach Expertendiskussion (s. Niehues et al. 2024) und weiteren Rückmeldungen aus der betrieblichen Praxis wurden einige Items umformuliert beziehungsweise nochmals anderen Dimensionen zugeordnet, um in der Anwendung für ein höheres Verständnis zu sorgen. Ferner wurden Items ergänzt, so dass derzeit 77 Items zu bewerten sind.
Anwendung des Verfahrens
Bei der Anwendung des KPB ist ein prozessorientiertes gestuftes Vorgehen vorgesehen, das sich in der betrieblichen Praxis als günstig erwiesen hat (Sandrock 2018; Hofmann et al. 2018). Im Vorfeld der tätigkeitsbezogenen Beurteilung hat es sich bewährt, bereits im Betrieb vorhandene Daten zu sichten; diese können Hinweise auf Bereiche beziehungsweise Unternehmenseinheiten geben, in denen von eher ungünstigen Belastungskonstellationen auszugehen ist (Sandrock 2018; Beck et al. 2022). Dazu gehört als erstes die Dokumentation einer bereits durchgeführten „technischen“ Gefährdungsbeurteilung.
Weitere Informationsquellen können beispielsweise sein:
Sofern darüber bereits im Betrieb Informationen vorhanden sind, sollten diese abteilungs- oder bereichsspezifisch geclustert werden, um Problembereiche zu identifizieren. In diesen wird dann mit der arbeitsplatz- beziehungsweise tätigkeitsbezogenen Beurteilung begonnen.
Der nächste Schritt besteht in der Festlegung von Tätigkeiten oder Arbeitsbereichen, wobei der Gesetzgeber vorsieht (vgl. ArbSchG § 5, Satz 2), dass vergleichbare Arbeitsplätze beziehungsweise Tätigkeiten zusammengefasst werden können. Dazu kann es sich anbieten, Stellenbeschreibungen zu sichten und zu vergleichen. Wichtig dabei ist, dass eine Zusammenfassung von Tätigkeiten plausibel und nachvollziehbar ist.
Die tätigkeitsbezogene Beurteilung erfolgt im Rahmen eines Beobachtungsinterviews mit Hilfe einer itembasierten Checkliste, die auf die entsprechenden Gestaltungsbereiche zielt. Dazu kann zum Beispiel mit Stelleninhaberinnen bzw. -inhabern und mit Führungskräften gesprochen werden.
Die Ergebnisse des Beobachtungsinterviews werden dokumentiert. Die Feststellung relevanter Faktoren kann basierend auf den Checklisten vorgenommen werden, die über eine dichotome Antwortskala erfassen, ob ein Merkmal zutrifft oder nicht. Die Auswertung erfolgt itembezogen, wobei auch die Anzahl der in eine Richtung deutenden Items eine Rolle spielt.
Das KPB bietet pro Item Gestaltungshinweise an, die sich nach Empfehlungen der GDA, DIN EN ISO 10075-2:2024 und sonstigen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und Hinweisen, so auch der Unfallversicherungsträger, richten.
Ein wesentlicher Vorteil von Vor-Ort-Begehungen besteht darin, dass sich – falls erforderlich – Maßnahmen vielfach direkt ableiten lassen. Bei Unternehmen mit einem Arbeitsschutzausschuss ist zu empfehlen, die festgestellten Gefährdungen durch psychische Belastung in diesem Gremium vorzustellen und zu besprechen.
Hinweise für die Praxis
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Bildung eines paritätisch besetzten Beurteilungsteams dann sinnvoll sein kann, wenn entsprechende Kenntnisse von den Tätigkeiten – und damit auch von der am Arbeitsplatz vorhandenen psychischen Belastung – vorliegen. In Ergänzung zur Beobachtung der Tätigkeit ist es vorgesehen, die Stelleninhaberinnen beziehungsweise -inhaber, die Führungskraft oder auch Kolleginnen bzw. Kollegen zu der Tätigkeit zu befragen, um beispielsweise Besonderheiten eines Arbeitssystems zu entdecken, die sich einer direkten Beobachtung nicht erschließen. Erfahrungsgemäß erhöht die Einbindung der Beschäftigten auch die Akzeptanz für die Gefährdungsbeurteilung (Hofmann et al. 2018). Die Ergebnisse des Einsatzes in Unternehmen zeigen dabei, dass die prozessorientierte Vorgehensweise von den Stakeholdern und Beschäftigten verstanden und akzeptiert wird. Der Fokus auf die Tätigkeit und auf den Arbeitsplatz hilft dabei weiter, das Thema „psychische Belastung“ zu entmystifizieren. Erfahrungen aus verschiedenen Branchen (z. B. Industrie, Dienstleistung, Softwareentwicklung, Werkstatt für behinderte Menschen) zeigen, dass das Instrument branchenübergreifend eingesetzt werden kann.
Interessenkonflikt: Das Autorenteam war an der Entwicklung des KPB beteiligt. Interessenkonflikte liegen nicht vor.