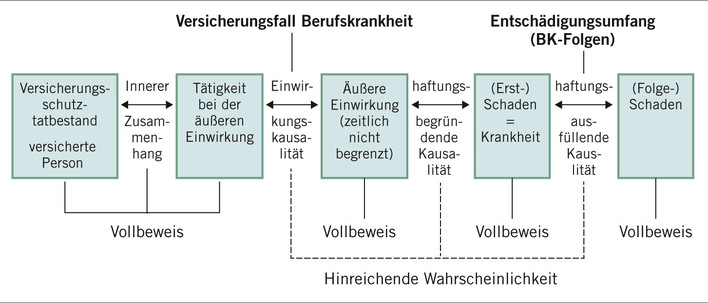Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
In unserer Serie „70 Jahre MAK-Kommission“ werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben die verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission vorstellen. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erfahren Sie, wie die MAK-Kommission auch heute noch eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Arbeitswelt von morgen sicherer und gesünder zu gestalten.
In Folge 5 der Interview-Reihe erläutert Frau Prof. Dr. Brunhilde Blömeke, Leiterin der AG Allergie, die spezifische Rolle ihrer Arbeitsgruppe innerhalb der Senatskommission.
70 Years of the MAK Commission: Paving the way for healthy workplaces (Part 5): Allergies in the workplace
The Allergy Working Group within the MAK Commission analyzes and evaluates relevant occupational allergens. Different approaches are used to assess the sensitizing potential – from published human data to validated non-animal data and computer-based predictions. The interview presents work-related allergy types and key substance groups that require preventive measures in companies, and also explains the role of diagnostics and the difference from general EU GHS classifications.
70 Jahre MAK-Kommission: Wegbereiter für gesunde Arbeitsplätze (Teil 5): Allergien am Arbeitsplatz
Die AG Allergie innerhalb der MAK-Kommission analysiert und bewertet relevante berufliche Allergene. Zur Einschätzung des sensibilisierenden Potenzials werden unterschiedliche Ansätze genutzt – von publizierten Humandaten bis hin zu Ergebnissen aus validierten nicht-tierbasierten und computergestützten Vorhersagen. Im Interview werden arbeitsbedingte Allergieformen und zentrale Stoffgruppen vorgestellt, die Präventionsmaßnahmen in Unternehmen erfordern, sowie die Rolle der Diagnostik und der Unterschied zu allgemeinen EU-GHS-Einstufungen erläutert.
Frau Professorin Blömeke, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der MAK-Kommission möchten wir einige Fragen an Sie als Leiterin der AG Allergie stellen. Die AG befasst sich mit einem hochrelevanten Aspekt des Arbeitsschutzes. Können Sie uns die spezifische Rolle Ihrer Arbeitsgruppe innerhalb der Senatskommission erläutern und wie Ihre Arbeit zur Identifizierung und Bewertung von arbeitsbedingten Allergierisiken beiträgt?
B. Blömeke: Beruflicher Umgang mit beziehungsweise die Aufnahme von Allergenen kann zu allergischen Erkrankungen wie zum Beispiel der Kontaktallergie oder dem allergischen Asthma führen. Aufgrund begrenzter Behandlungsmöglichkeiten sind die Betroffenen erheblich in ihrer beruflichen Tätigkeit eingeschränkt. Da zudem bei anhaltender Exposition die Gefahr einer Verschlimmerung der Erkrankungen groß ist, kann auch ein Berufswechsel nötig werden.
Zur Unterstützung der Prävention in diesem Bereich analysiert und bewertet die AG Allergie Substanzen hinsichtlich ihres sensibilisierenden beziehungsweise (photo-)allergenen Potenzials, und zwar sowohl nach Hautkontakt als auch nach Inhalation und insbesondere am Arbeitsplatz. Wir erstellen umfangreiche wissenschaftliche Texte, die begründen, ob und warum eine Substanz als relevantes berufliches Allergen markiert werden solle oder eben nicht. Dies erfolgt für alle Stoffe, die in der MAK-Kommission behandelt werden, und wir überprüfen zudem regelmäßig, ob neue Daten eine Neubewertung bereits bewerteter Substanzen erforderlich machen. Unser Ziel ist es, durch wissenschaftlich begründete Substanzbewertungen und Schlussfolgerungen einen Beitrag zum Arbeitsschutz und zur Prävention berufsbedingter Allergien zu leisten.
Die Beurteilung des allergenen Potenzials von Arbeitsstoffen ist komplex und erfordert spezielle Methoden. Welche Ansätze verfolgt Ihre Arbeitsgruppe, um die sensibilisierende Wirkung von Substanzen zu bewerten?
B. Blömeke: Die Bewertung des allergenen Potenzials von Arbeitsstoffen ist in der Tat komplex. Zunächst prüfen wir die publizierten Daten dahingehend, ob eine Substanz ein allergenes Potenzial besitzt, also grundsätzlich in der Lage ist, eine allergische Reaktion beim Menschen auszulösen. Außerdem werden bestehende Ergebnisse aus tierexperimentellen Untersuchungen bei der Bewertung berücksichtigt, insbesondere, wenn keine oder nur unzureichende Humandaten vorliegen. Darüber hinaus berücksichtigen wir zunehmend Ergebnisse von validierten nicht-tierbasierten Test- methoden sowie computergestützte Vorhersagen. Letztere haben inzwischen für eine Reihe von Stoffgruppen eine hohe Vorhersagekraft für den Menschen und ermöglichen eine fundierte Bewertung. Weiterhin klären wir, ob das allergene Potenzial einer Substanz auch am Arbeitsplatz relevant ist: Besteht dort tatsächlich Kontakt zu der Substanz und gibt es dokumentierte Fälle, die auf eine berufliche Sensibilisierung hindeuten? Dies bestimmt maßgeblich unsere abschließende Bewertung, denn unsere Markierung beruht auf der konkreten Relevanz eines Allergens am Arbeitsplatz. In diesem Aspekt unterscheidet sich die Arbeitsweise der AG Allergie von anderen Kommissionen. Während zum Beispiel für die EU-GHS-Klassifikation die grundsätzliche Allergenität einer Substanz in den Fokus gestellt wird, betrachten wir explizit die arbeitsplatzbezogene Situation. Das führt dazu, dass wir in bestimmten Fällen zu anderen Schlussfolgerungen kommen können, wie etwa zuletzt beim Beispiel Dibenzoylperoxid (Egele et al. 2025).
Welche Arten von berufsbedingten Allergien stehen im Fokus Ihrer Arbeitsgruppe und welche Stoffgruppen sind hierbei besonders relevant? Können Sie verdeutlichen, wie die Erkenntnisse Ihrer AG dazu beitragen, Präventionsstrategien zu entwickeln, um das Auftreten von berufsbedingten Allergien effektiv zu vermeiden?
B. Blömeke: Die Arbeitsgruppe bewertet überwiegend Substanzen, die zu Kontaktallergien vom Spättyp (Typ IV) führen, sowie die selteneren inhalativen Allergien vom Soforttyp (Typ I). Bei den Kontaktallergenen sind Metalle wie Nickel-, Kobalt- und Chrom-VI-Verbindungen sicherlich die häufigsten Vertreter, es gibt aber auch zahlreiche organische Verbindungen, die beruflich relevante Kontaktallergene sind. Hier sind zum Beispiel Methylchloroisothiazolinon/Methylisothiazolinon (MCI/MI) und die Gruppe der Formaldehyd-freisetzenden Substanzen zu nennen, die als Biozide häufig beispielsweise in Kühl- und Schmierstoffen, Farben und Lacken eingesetzt werden (Schubert et al. 2020), oder die Epoxidharz-Systeme, die bei der zunehmenden Bedeutung der Bauchemie als Allergene relevant geworden sind. Bei IgE-vermittelten Inhalationsallergien handelt es sich häufig um hochmolekulare Allergene (z. B. Enzyme), seltener um niedermolekulare Chemikalien (z. B. Trimellitsäureanhydrid) (Schwab u. Poole 2023).
Die von der AG Allergie vorgeschlagenen Bewertungen werden in der gesamten MAK-Kommission abgestimmt. Nachfolgend wird die Markierung sensibilisierender Stoffe mit „Sh“ (für Kontaktallergene), „SP“ (für Photokontaktallergene) oder „Sa“ (für Atemwegsallergene) zusammen mit den MAK- und BAT-Werten und anderen Markierungen oder Einstufungen in der jährlich erscheinenden MAK- und BAT-Werte-Liste veröffentlicht. Die dazugehörigen Begründungen werden separat im „Open Access“ auf der PUBLISSO-Plattform von ZB MED in der „MAK Collection“ veröffentlicht und stellen umfangreiche Zusammenfassungen der verfügbaren Literatur und transparente Argumentationen dar, die einer Markierung oder Nicht-Markierung zugrunde liegen. Die vorgenommenen Markierungen und Werte bieten die wissenschaftliche Grundlage für den Ausschuss für Gefahrstoffe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der die Vorschläge aufgreifen und in konkrete Regulationen umsetzen kann. In Bezug auf eine Markierung einer Substanz als sensibilisierend führt dies zu gezielten präventiven Maßnahmen in Form von technischen Schutzvorkehrungen, Substitutionsprüfungen, Hautschutzkonzepten und arbeitsmedizinischen Vorsorgeprogrammen, die helfen, das Auftreten berufsbedingter Allergien zu vermeiden.
Allergische Reaktionen können auch bei Expositionen auftreten, die unterhalb klassischer MAK-Werte liegen. Wie erfolgt der Austausch und die Zusammenarbeit Ihrer AG mit anderen Arbeitsgruppen, wie der AG Luftanalysen oder der AG Biomonitoring, um ein umfassendes Bild der Exposition zu erhalten und die allergene Wirkung zu bewerten?
B. Blömeke: Die Markierung von Stoffen als beruflich relevante Allergene erfolgt unabhängig von der Festsetzung eines MAK-Werts (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2025). Dies beruht darauf, dass wir keine quantitative Grenze festlegen können, unterhalb derer keine Person reagiert. In der Tat kann bei einzelnen Personen eine Reaktion bereits bei sehr niedrigen Expositionen auftreten, zum Teil deutlich unterhalb klassischer MAK-Werte. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen hilfreich. Manche Mitglieder unserer Arbeitsgruppe sind zugleich auch in anderen Arbeitsgruppen vertreten, was den Austausch zusätzlich erleichtert. Monitoring-Daten liefern eine wertvolle Ergänzung für die Beurteilung der Expositionshöhe und ermöglichen es, die Plausibilität einer berufsbedingten Sensibilisierung besser einzuschätzen, beispielsweise durch die Einordnung, in welchem Bereich sich die tatsächliche Exposition am Arbeitsplatz bewegt. Dies setzt allerdings voraus, dass es sich um Stoffe handelt, die im Rahmen des Monitorings erfasst werden können, beziehungsweise für die entsprechende quantitative Methoden zur Verfügung stehen.
Ihre Arbeit ist entscheidend für die Praxis. Welche neuen Entwicklungen gibt es im Bereich der Diagnostik von berufsbedingten Allergien, die für Betriebsärztinnen und -ärzte relevant sind? Und welche Empfehlungen spricht Ihre Arbeitsgruppe aus, um das Management von sensibilisierenden Stoffen in Unternehmen zu ermöglichen?
B. Blömeke: Im Bereich der Diagnostik berufsbedingter Allergien sind insbesondere herausfordernde, aber auch einige positive Entwicklungen zu beobachten. Schwierigkeiten bereitet die abnehmende Verfügbarkeit von Testmaterialien zur Diagnose von Berufsallergien (Epikutan- und Pricktest), wodurch die standardisierte Diagnostik bei Kontakt- und Atemwegsallergien deutlich eingeschränkt ist. Auch Lösungen für nasale und bronchiale Provokationen mit allergenen Arbeitsstoffextrakten werden von der Industrie immer weniger angeboten, was die Testung deren Relevanz stark erschwert. Um dennoch eine Diagnostik zu ermöglichen, sind Testungen mit patienteneigenem Material (z. B. am Arbeitsplatz verwendete Produkte oder Rohstoffe) von zunehmender Bedeutung.
Erfreulich ist die Entwicklung auf dem Gebiet der nicht-invasiven Methoden zur Erfassung von Entzündungen der Atemwege und Asthma. Für die Diagnose von Berufsasthma stehen ergänzend zur Lungenfunktionsprüfung nun auch Standards für die Nutzung nicht-invasiver Parameter wie das fraktionierte exhalierte Stickstoffmonoxid im Zeitverlauf, die wiederholte Methacholinprovokation und Sputumanalysen mit und ohne Arbeitsstoffexposition zur Verfügung. Zusätzlich erlauben die Kombination und Ausprägung dieser Parameter Rückschlüsse auf den zugrunde liegenden Asthma-Phänotyp. Das ist für Betriebsärztinnen und -ärzte besonders relevant, um gezielt zwischen einem allergischen, reizstoffinduzierten oder gemischtförmigen Asthma zu unterscheiden und so arbeitsplatzbezogene Präventions- und Behandlungsstrategien individuell anzupassen. Unterstützend stehen Apps und digitale Plattformen zur Verfügung, die die Symptome und Befunde in Abhängigkeit von Expositionsmustern am Arbeitsplatz im Vergleich zu nicht exponierten Phasen (z. B. Urlaub) erfassen und somit zur Objektivierung und Diagnostik von Berufsasthma beitragen.
Eine weitere entscheidende Wendung war auch der Wegfall des Unterlassungszwangs als Voraussetzung zur Anerkennung für bestimmte Berufskrankheiten, unter anderem BK 5101 (Haut), 4301, 4302, 1315 (Atemwege), mit Wirkung zum 01.01.2021. Das bedeutet, Versicherte müssen inzwischen die schädigende Tätigkeit nicht mehr aufgeben, um eine Berufskrankheit anerkannt zu bekommen. Zugleich stellt die Weiterarbeit unter fortgesetzter potenziell schädigender Allergenexposition vor neue Herausforderungen.
Zum zweiten Teil der Frage: Wie bereits erläutert liegt das eigentliche Risikomanagement sensibilisierender Arbeitsstoffe nicht im Aufgabenbereich der AG Allergie und der MAK-Kommission und wir geben keine Handlungsempfehlungen für Unternehmen. In diesem Zusammenhang ist noch einmal festzuhalten, dass die Einhaltung von MAK-Werten nicht zwingend vor Sensibilisierung (Induktion) und Auslösung einer allergischen Reaktion schützt! Des Weiteren sollte gezielt das Verständnis für die individuelle Empfindlichkeit (Suszeptibilität) geschaffen werden. Auch wenn Kolleginnen und Kollegen seit Jahren problemlos mit zum Beispiel Enzymstaub arbeiten, können empfindlichere Personen (z. B. Personen mit Atopie oder Allergien gegenüber ubiquitären Allergenen) durch unachtsames Verhalten gefährdet werden.
Frau Professorin Blömeke, vielen Dank für das Gespräch!
Literatur
Egele K, Drexler H, Fartasch M, van Kampen V, Merk HF, Nowak D, Schnuch A, Uter W, Kreis P, Blömeke B: Benzoyl peroxide’s sensitisation potential and potency in experimental methods and review of contact allergy and allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis 2025; 92: 436–445. https://doi.org/10.1111/cod.14765 (Open Access).
Schubert S, Brans R, Reich A, Buhl T, Skudlik C, Schröder-Kraft C, Gina M, Weisshaar E, Mahler V, Dickel H, Schön MP, John SM, Geier J, for the IVDK: Contact sensitization in metalworkers: Data from the information network of departments of dermatology (IVDK), 2010–2018. Contact Dermatitis 2020; 83: 487–496. https://doi.org/10.1111/cod.13686 (Open Access).
Schwab AD, Poole JA: Mechanistic and therapeutic approaches to occupational exposure-associated allergic and non-allergic asthmatic disease. Curr Allergy
Asthma Rep 2023; 23(6): 313–324. https://doi.org/10.1007/s11882-023-01079-w.
Kontakt
Online-Quelle
Deutsche Forschungsgemeinschaft (2025) MAK- und BAT-Werte-Liste 2025: Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe – Mitteilung 61. German Medical Science GMS Publishing House
https://series.publisso.de/sites/default/files/documents/series/mak/lmb…