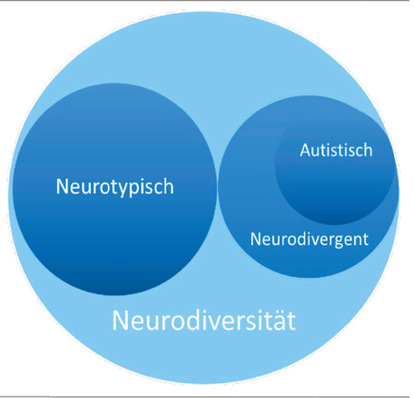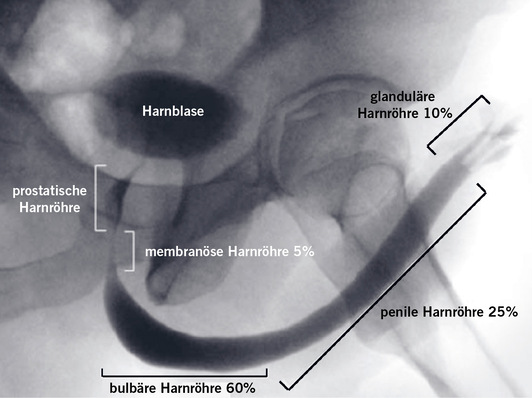Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Apps in Occupational Health Care – An Overview of Use Cases and Potential
Digital applications are increasingly finding their way into workplace settings. This article provides an overview of various areas of application and highlights functions that are particularly relevant to occupational health care. In addition to concrete examples, it also offers practical guidance on how to use digital tools effectively. Our two-part article provides a structured overview: The following Part 1 presents the use of apps in traditional occupational safety and health, as well as in occupational health practice. In one of the following ASU issues, Part 2 will focus on dedicated apps for Workplace Health Management (WHM) and Workplace Health Promotion (WHP), as well as on the use of Digital Health Applications (DiGAs) in occupational health care.
Kernaussagen
Apps in der arbeitsmedizinischen Betreuung – ein Überblick über Einsatzfelder und Potenziale
Digitale Anwendungen halten zunehmend Einzug in die betriebliche Praxis. Der Artikel gibt einen Überblick über verschiedene Einsatzfelder und beleuchtet Funktionen, die speziell für die arbeitsmedizinische Betreuung von Bedeutung sind. Neben konkreten Beispielen enthält er auch praxisnahe Hinweise zur Nutzung digitaler Tools. Unser zweiteiliger Beitrag bietet einen systematischen Überblick: Der folgende Teil 1 stellt den Einsatz von Apps im klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie in der arbeitsmedizinischen Praxis vor. Teil 2 wird in einer der folgenden ASU-Ausgaben auf spezielle Apps für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sowie den Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs) in der arbeitsmedizinischen Betreuung eingehen.
Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin sinnvoll einsetzen
Ob Zeiterfassung, Teamkommunikation oder tätigkeitsbezogene Spezialsoftware – digitale Anwendungen durchdringen heute nahezu alle Bereiche des Arbeitslebens. Auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie in der Arbeitsmedizin eröffnet sich damit ein breites Spektrum an digitalen Werkzeugen. Sie versprechen schnelleres Handeln, präzisere Dokumentation und einen direkteren Draht zu den Beschäftigten. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Datenschutz, Prozessintegration und medizinische Validität.
Die Vielzahl an verfügbaren Anwendungen verleitet jedoch nicht selten zum ungezielten Sammeln von Apps – oft ohne strategisches Konzept oder klare Zielsetzung. Dieser Beitrag bietet eine erste Orientierung im App-Wald: Er klassifiziert zentrale App-Typen nach ihrem Nutzen im arbeitsmedizinischen und betrieblichen Alltag und benennt, worauf Fachpersonen vor der Einführung achten sollten – von der datenschutzrechtlichen Einordnung über rechtliche Rahmenbedingungen bis zur praktischen Integration in bestehende Systeme und
Abläufe.
Zunächst lohnt ein kurzer Blick auf den Begriff selbst: Was genau ist eigentlich eine App? Der Begriff „App“ ist die Kurzform von „Application“ (englisch für „Anwendung“) und bezeichnet jede Software mit einer klar umrissenen Funktion – etwa zur Messung, Kommunikation, Dokumentation oder Berechnung. Apps können in unterschiedlichen technischen Formen auftreten, was die Funktionalität mitbestimmt:
Trotz dieser Vielfalt eint alle Anwendungen ein gemeinsames Profil: eine spezifische Funktion, eine benutzerorientierte Oberfläche oder Schnittstelle (User Interface, UI) und die Fähigkeit, eigenständig oder eingebettet in größere Softwaresysteme zu arbeiten.
Für eine praxisnahe Einordnung lassen sich arbeitsmedizinisch relevante Apps nach ihrer Funktionalität grob vier Anwendungsbereichen beziehungsweise Dimensionen zuordnen:
(DiGAs): vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüfte, verordnungsfähige digitale Therapiebegleiter mit belegtem Versorgungseffekt.
Für jede dieser Kategorien stellt der Beitrag exemplarische Lösungen vor und diskutiert kritische Aspekte wie Datenschutz, Nachweispflichten und Integration in betriebliche Abläufe. Die Auswahl versteht sich nicht als Produktempfehlung, sondern als praxisnahe Orientierungshilfe: Welche digitalen Bausteine sind für wen, in welcher Situation, wirklich hilfreich und worauf ist bei Auswahl und Einführung zu achten?
Klassischer Arbeits- und Gesundheitsschutz
Apps im klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz unterstützen zentrale Aufgaben der Prävention – etwa bei der Gefährdungsbeurteilung, dem Umgebungsmonitoring, der Durchführung von Unterweisungen oder im Notfallmanagement. Sie helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Schutzmaßnahmen gezielter umzusetzen und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren – Fachkräfte für Arbeitssicherheit, betriebliche Führungskräfte sowie Betriebsärztinnen und -ärzte
– effizienter zu gestalten.
Gerade in dezentralen und dynamischen Arbeitsumgebungen – etwa auf Baustellen, in der mobilen Instandhaltung oder in Produktionsbereichen mit häufigem Arbeitsplatzwechsel – ermöglichen digitale Anwendungen eine zeit- und ortsnahe Bereitstellung belastbarer Informationen. Für betriebsärztliches Personal entstehen dadurch neue Möglichkeiten, medizinische Expertise gezielt in den betrieblichen Alltag einzubringen: Daten lassen sich strukturiert erheben, fundiert bewerten und rechtssicher dokumentieren.
Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben vier zentrale App-Typen im klassischen Arbeitsschutz. Für alle gelten grundlegende Anforderungen, die bei Auswahl, Einführung und Nutzung zu berücksichtigen sind:
Umgebungsmonitoring
Apps für das Umgebungsmonitoring kommen überall dort zum Einsatz, wo ein schneller, lokaler Überblick über gesundheitsrelevante Einflussfaktoren erforderlich ist. Beispiele sind Hitzewarn-Apps, UV-Indizes, Unwetterwarnsysteme, Lärmsensorik oder CO2-Messungen in Innenräumen. Auch Feinstaub-, Luftfeuchtigkeits- oder Temperaturdaten können für Prävention und arbeitsmedizinische Bewertung hilfreich sein (siehe auch Kasten).
Die Anwendungen fördern die Eigenverantwortung der Beschäftigten, bieten Entscheidungsgrundlagen für Schutzmaßnahmen und erleichtern es Führungskräften, Auffälligkeiten direkt in die Gefährdungsbeurteilung zu überführen. Für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ergibt sich ein direkter praktischer Nutzen: Aktuelle Belastungssituationen können zügig eingeschätzt und medizinisch dokumentiert werden.
Besonders zu beachten:
Schulungen, Unterweisungen, Glossare
Digitale Werkzeuge erleichtern die Planung, Durchführung und Dokumentation von Unterweisungen – insbesondere bei wechselnden Einsatzorten, heterogenen Belegschaften oder hohem Schulungsbedarf in engen Zeitfenstern. Auch betriebsärztlich relevante Inhalte wie ergonomisches Arbeiten, Hitzeprävention oder Umgang mit Gefahrstoffen lassen sich auf diese Weise zugänglich machen.
Die Expertise von Betriebsärztinnen und -ärzten ist hier in vielfältiger Weise gefragt: Sie stellen nicht nur die fachlichen Inhalte bereit, sondern sind auch maßgeblich an der didaktischen Aufbereitung, der Durchführung und der Evaluation beteiligt. Gute Unterweisungs-Apps bieten modulare Inhalte, ermöglichen mobile Durchführung (z. B. per Tablet vor Ort), erzeugen automatisierte Nachweise und lassen sich in vorhandene Systeme einbinden.
Besonders zu beachten:
Gefährdungsbeurteilung
Apps zur Gefährdungsbeurteilung sind besonders nützlich, wenn vor Ort – etwa bei neuen Tätigkeiten oder veränderten Arbeitsbedingungen – schnell und strukturiert Risiken erfasst werden sollen. Sie helfen dabei, relevante Gefährdungen systematisch zu bewerten, Maßnahmen zu dokumentieren und die Ergebnisse rechtssicher zu archivieren.
Ein Beispiel ist der Praxis-Check der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), der durch dialoggeführte Eingaben eine systematische Erhebung ermöglicht. Ärztliches Personal erhält so eine nachvollziehbare Grundlage für Empfehlungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge oder weiteren Schutzmaßnahmen.
Besonders zu beachten:
Notfallmanagement
Apps für das betriebliche Notfallmanagement verbessern die Reaktionszeiten und erhöhen die Handlungssicherheit – insbesondere bei mobiler Arbeit, auf Baustellen oder bei Alleinarbeit. Sie bieten Funktionen zur Sofortalarmierung, zur Standortlokalisierung von Ersthelfenden oder automatisierten Übertragung medizinisch relevanter Daten an Rettungsleitstellen.
Aus arbeitsmedizinischer Sicht bieten diese Anwendungen nicht nur präventiven Nutzen, sondern auch Vorteile in der Analyse: automatisch erfasste Notfallprotokolle, Verbandbucheinträge oder Alarmverläufe unterstützen die Präventionsplanung, die Dokumentation in ASA-Sitzungen und die Evaluation von Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Besonders zu beachten:
Arbeitsmedizinische Praxis
Digitale Anwendungen unterstützen Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zunehmend bei der Bewältigung ihres anspruchsvollen Alltags – sei es bei der Organisation von Terminen, der Durchführung mobiler Vorsorgen, der Anbindung an Praxissoftware oder bei der rechtssicheren Dokumentation ärztlicher Maßnahmen. Richtig eingesetzt, steigern sie nicht nur Effizienz und Versorgungsqualität, sondern stärken auch die Schnittstellen zwischen Medizin, Arbeitsschutz und Personalabteilung.
Der größte Nutzen ergibt sich dort, wo digitale Tools sinnvoll in bestehende Prozesse eingebunden sind, Datenschutz und Schweigepflicht gewahrt bleiben und die ärztliche Entscheidungsfreiheit uneingeschränkt erhalten bleibt. Die Herausforderung liegt weniger in der Technik, sondern in deren rechtssicherer und praxistauglicher Umsetzung.
Auch im Bereich der arbeitsmedizinischen Praxis gelten daher übergreifende Anforderungen für die Auswahl und Nutzung digitaler Lösungen:
Terminplanung, Telemedizin, Aktenführung
Digitale Tools zur Organisation und Kommunikation gehören mittlerweile zur Grundausstattung vieler arbeitsmedizinischer Dienste. Sie ermöglichen eine automatisierte Terminplanung, verschlüsselte Kommunikation mit Beschäftigten und Führungskräften sowie eine revisionssichere Dokumentation.
Mitarbeitende können Vorsorgen online buchen, Unterlagen hochladen und erhalten Bescheinigungen direkt in digitaler Form. Videosprechstunden ersetzen bei geeigneten Fragestellungen den Vor-Ort-Termin, mobile Formulare dokumentieren Befunde direkt während der Begehung. Im Idealfall erfolgt dies alles integriert über ein einziges Softwaresystem, so dass Medienbrüche vermieden, Doppelerfassungen reduziert und Datenschutzanforderungen erfüllt werden.
Besonders zu beachten:
Diagnostik und Screening
Apps für Diagnostik und Screening bringen die arbeitsmedizinische Untersuchung näher an den Arbeitsplatz: mobile Sehtests über die Smartphone-Kamera, Hörtests mit zertifizierten Kopfhörern, CO2- oder Temperaturmessung mit angeschlossenen Sensoren. Auch erste Stimmungs- oder Stress-Screenings lassen sich über validierte Fragebögen durchführen.
Solche Anwendungen können die ärztliche Diagnostik nicht ersetzen, wohl aber vorbereiten und strukturieren. Besonders bei Voruntersuchungen, Wiedereingliederungen oder in der arbeitsplatznahen Vorsorge ermöglichen sie eine frühzeitige Einschätzung und zielgerichtete Weiterverfolgung.
Besonders zu beachten:
Wearables und Biomonitoring
Tragbare Sensoren – sogenannte Wearables – eröffnen neue Perspektiven für das arbeitsmedizinische Monitoring: Belastungsspitzen lassen sich in Echtzeit erkennen, individuelle Verlaufskurven objektiv nachvollziehen und Gefährdungspotenziale datenbasiert erfassen. Dabei kommen neben den schon bekannten Armbändern und Uhren auch beispielsweise Ringe, mit Sensoren bestückte Textilien oder Exoskelette zum Einsatz.
Typische Einsatzfelder sind thermische oder physische Belastung, Schlaf- und Erholungsanalyse oder Vitaldatenüberwachung bei besonderen Arbeitsbedingungen (z. B. im Schichtdienst, bei Exposition gegenüber Gefahrstoffen oder bei Tätigkeiten mit hoher körperlicher Beanspruchung). Die zugehörige App übernimmt dabei die Erfassung, Aufbereitung und Auswertung und stellt relevante Daten für ärztliche Bewertungen bereit.
Besonders zu beachten:
Compliance, Audits und Reporting
Digitale Werkzeuge zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und für das Berichtswesen gewinnen auch in der Arbeitsmedizin an Bedeutung. Sie erfassen Fristen aus der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), bereiten Kennzahlen für ASA-Sitzungen oder interne Audits auf und erzeugen automatisierte Berichte für Qualitätsmanagement oder externe Prüfstellen.
Diese Tools ermöglichen nicht nur eine höhere Datenqualität und Transparenz, sondern fördern auch strategische Gesundheitsplanung – etwa durch Trendanalysen, Frühwarnsysteme oder Benchmarking. Entscheidend ist dabei, dass die Auswertungen differenziert, datenschutzkonform und rollenbasiert erfolgen.
Besonders zu beachten:
In einer der folgenden ASU-Ausgaben werden im zweiten Teil Apps für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sowie Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) vorgestellt.▪
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Foto: Smallroombigdream - stock.adobe.com
Apps für Umweltmonitoring
https://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqu…
und Handlungsempfehlungen (Schatten, Schutzkleidung) in mehreren Sprachen; unterstützt arbeitsmedizinische Haut- und Augenschutzprogramme weltweit.
https://www.who.int/tools/sunsmart-global-uv-app
https://www.baua.de/DE/Themen/Chemikalien-Biostoffe/Gefahrstoffe/EMKG/E…
https://www.umweltbundesamt.de/app-luftqualitaet
Apps für Schulungen und Unterweisungen
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/bauste…
(BG RCI) – Smartphone-App für Technik-, Instandhaltungs- und Arbeitsschutzfachleute: Geführte Checklisten zur rechtskonformen Maschinenabnahme mit PDF-Export für Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungsnachweis.
https://www.bgrci.de/praevention/praeventionsmedien/digitales/apps
Apps für die Gefährdungsbeurteilung
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehr…
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/digita…
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-…app-ergaenzende-gefaehrdungsbeurteilung
(SiFas) kleiner/mittlerer Betriebe: interaktiver Organisations-Check mit Ampelsystem, Maßnahmenplan und Benchmarking zur Gefährdungsbeurteilung und zum Arbeitsschutzmanagement.
https://www.gda-orgacheck.de/daten/gda/index.htm
Apps für das Notfallmanagement
Apps für Diagnostik und Screening
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-di…
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-di…
Nierenfunktion, Harnwegsinfektionen und Schwangerschaftskomplikationen einsetzbar; Wundmessung umfasst 3D-Modelle chronischer Läsionen zur Verlaufskontrolle.
Apps zu compliance, Audits und Reporting
https://bgn-unterweisungsplaner.app/
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehr…