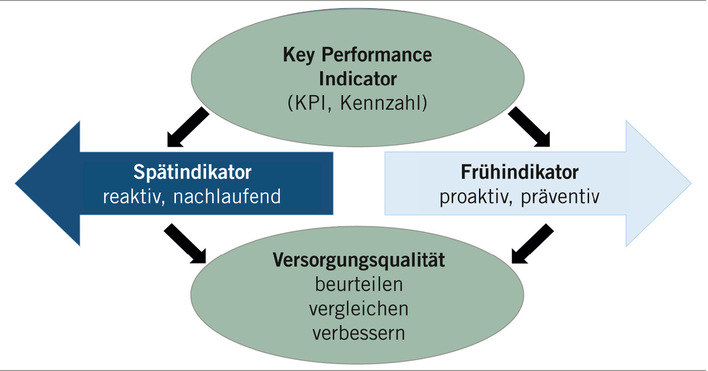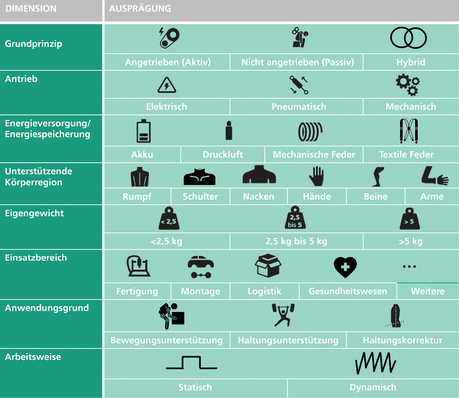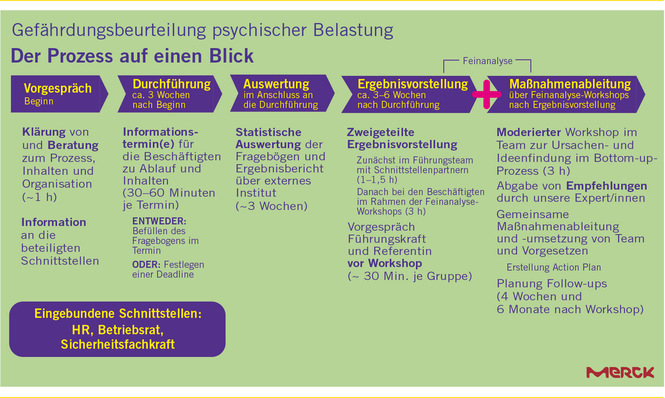Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Die MAK-Kommission ist ein unverzichtbarer Pfeiler des Arbeitsschut- zes. Ihre wissenschaftlich fundierten Empfehlungen und Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Stoffe sind die Grundlage für Präventi- onsmaßnahmen und Schutzvorschriften in zahlreichen Branchen. Dies ist das Ergebnis der engagierten Arbeit von Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen – von der Toxikologie über die Arbeitsmedizin und Chemie bis hin zur Pathologie und Messtechnik.
In unserer Serie „70 Jahre MAK-Kommission“ werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben die verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission vorstellen. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erfahren Sie, wie die MAK-Kommission auch heute noch eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Arbeitswelt von morgen sicherer und gesünder zu gestalten.
In der zweiten Folge der Interview-Reihe beschreibt Prof. Dr. Hans Drexler, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Beurteilungswerte in biologischem Material“, wie diese, zusammen mit der Arbeitsgruppe „Biomonitoring“ (siehe Interview in der nächsten ASU-Ausgabe), die wissenschaftlich basierten Voraussetzungen für die Durchführung des Biomonitorings schafft.
70 Years of the MAK Commission: Paving the way for healthy workplaces (Part 2): Assessment Values in Biological Material (BAT values)
In the following interview, Professor Drexler explains why biological limit values (BAT values) are an important complement to air quality measurements and how they help to better assess actual exposure to substances in the workplace. He also provides insights into the challenges involved in setting these values and their significance for occupational health prevention.
70 Jahre MAK-Kommission: Wegbereiter für gesunde Arbeitsplätze (Teil 2): Beurteilungswerte in biologischem Material (BAT-Werte)
Im folgenden Gespräch erklärt Herr Professor Drexler, warum biologische Grenzwerte (BAT-Werte) eine wichtige Ergänzung zu Luftmessungen sind und wie sie helfen, die tatsächliche Belastung durch Arbeitsstoffe besser zu erfassen. Außerdem gibt er Einblicke in die Herausforderungen bei der Festlegung dieser Werte und deren Bedeutung für die arbeitsmedizinische Prävention.
Herr Professor Drexler, die MAK-Kommission feiert ihr 70-jähriges Jubiläum, und die Arbeit Ihrer BAT-Arbeitsgruppe ist untrennbar mit den MAK-Werten verbunden. Können Sie uns erläutern, wie sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen der MAK- und der BAT-Arbeitsgruppe über die Jahre entwickelt haben und welche Bedeutung diese enge Kooperation für die ganzheitliche Beurteilung von Arbeitsstoffexpositionen hat?
H. Drexler: Beide Arbeitsgruppen leiten Grenzwerte ab, die die Gesundheit der Beschäftigten schützen sollen. Die Bewertung von Studienergebnissen erfolgt innerhalb der Kommission nach den gleichen Regeln. Wenn ein Arbeitsstoff in biologischem Material nachweisbar ist, sind es in der Regel die gleichen Studien, die zur Grenzwertableitung herangezogen werden. In den letzten Jahren arbeiten die MAK- und die BAT-Arbeitsgruppe eng zusammen. Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Mitglieder in beiden Arbeitsgruppen. Darüber hinaus haben sich stoffbezogene Online-Sitzungen unter Beteiligung aller Arbeitsgruppen sehr bewährt. Dadurch ist es möglich geworden, dass neue oder reevaluierte Grenzwerte in der Luft und in biologischem Material kurzfristig aufeinander abgestimmt und zeitgleich veröffentlicht werden können.
Die BAT-Werte ermöglichen die Beurteilung der inneren Exposition gegenüber Arbeitsstoffen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile dieser biologischen Überwachung im Vergleich zu reinen Messungen der Stoffkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz? Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wo der BAT-Wert eine entscheidende Rolle für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten spielt, die ein MAK-Wert allein nicht abdecken könnte?
H. Drexler: Das Biomonitoring erfasst die biologisch relevante Exposition, das heißt die tatsächliche Belastung durch inhalative, dermale und gegebenenfalls orale Aufnahme sowie den Einfluss individueller Faktoren wie zum Beispiel Körpergewicht und Stoffwechsel, bei Substanzen mit systemischer Toxizität. Die Luftwerte sind in diesem Fall nur ein Surrogat für die Gefährdung. Bei Stoffen mit langer Halbwertszeit im Körper oder Stoffen, die auch über die Haut aufgenommen werden können, kann die Einhaltung von Luftgrenzwerten die Gesundheit der Beschäftigten nicht sicher schützen. Dem Rechnung tragend, wird beispielsweise in der MAK-Begründung zu Blei ausgeführt, dass der beste Parameter zur Abbildung einer Bleibelastung die aktuelle Blutbleikonzentration und der BAT-Wert von 150 µg Blei/l Blut unbedingt einzuhalten ist. Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat erstmals beim Blei nur einen Biologischen Grenzwert (BGW) und keinen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) abgeleitet.
Die Ableitung von BAT-Werten ist ein komplexer wissenschaftlicher Prozess. Welche besonderen Herausforderungen begegnen Ihrer Arbeitsgruppe bei der Festlegung dieser Werte, beispielsweise im Hinblick auf die Variabilität des menschlichen Stoffwechsels, die Verfügbarkeit geeigneter Biomarker oder die Berücksichtigung nicht-beruflicher Expositionen?
H. Drexler: Die größte Herausforderung ist es, Studien mit ausreichender Qualität und ausreichender Zahl von Beschäftigten zu identifizieren. Die Variabilität des menschlichen Stoffwechsels wird meist überschätzt. Der Parameter, für den der BAT-Wert abgeleitet wird, sollte für den entsprechenden Arbeitsstoff möglichst spezifisch sein, zum Beispiel die unveränderte Substanz selbst oder (fast) ausschließlich aus dem Arbeitsstoff gebildete Metaboliten oder spezifische Beanspruchungsindikatoren, wie die Hemmung der Acetylcholinesterase. Wenn es möglich ist, wählen wir für die Ableitung eines BAT-Wertes einen kritischen Metaboliten, der die Toxizität bestimmt. Bei jeder Grenzwertableitung haben wir ein Kapitel zur Hintergrundbelastung. Die Abgrenzung zur nicht-beruflichen Exposition ist damit einfach. Grenzwerte unterhalb des Referenzwertes für die Allgemeinbevölkerung werden nicht abgeleitet. Unter Umständen kann durch die Auswahl des Humanbiomonitoringparameters, wie beispielsweise der Speziesbestimmung, eine Verfälschung der beruflichen durch eine nicht-berufliche Belastung verhindert werden (z. B. Biologischer Leitwert (BLW) für die Summe von Arsen(III), Arsen(V) und Monomethylarsonsäure ohne die oft alimentär erhöhte Dimethylarsinsäure).
Wie tragen die von Ihrer Arbeitsgruppe erarbeiteten BAT-Werte zur Weiterentwicklung der arbeitsmedizinischen Prävention bei, und inwieweit beeinflusst die Arbeit der BAT-Arbeitsgruppe die Forschung im Bereich der Biomonitoringmethoden und der Toxikologie?
H. Drexler: Die BAT-Werte werden nach ihrer Publikation in der MAK- und BAT-Werte-Liste und der anschließenden Kommentierungsphase in der Regel vom AGS als Biologische Grenzwerte (BGW) in die TRGS (Technische Regel für Gefahrstoffe) 903 übernommen und in der arbeitsmedizinischen Vorsorge eingesetzt. Bei wiederholter Exposition gegenüber krebserzeugenden Arbeitsstoffen fordert die ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge) eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge. Zentraler Bestandteil ist dabei die Beratung der Beschäftigten. Ein sinnvolles Untersuchungsangebot ist das biologische Monitoring, wenn Werte zur Beurteilung vorliegen. Dieses erlaubt dann eine quantitative Aussage zum Risiko, wenn Expositions-Risiko-Beziehungen in der TRGS 910 des AGS und Äquivalenzwerte in biologischem Material vorliegen, die in der Regel aus den EKA (Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe, d. h. Beziehungen zwischen der Stoffkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz und der Stoff- bzw. Metabolitenkonzentration in biologischem Material) der BAT-Arbeitsgruppe abgeleitet werden. Liegen nur Biologische Arbeitsstoff-Referenzwerte (BAR) vor, kann zumindest semiquantitativ das Risiko eingeschätzt werden.
Immer wenn ein Beurteilungswert abgeleitet werden soll, stellt sich die Frage, ob ein validiertes Analyseverfahren existiert. Hier ist die enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Biomonitoring unverzichtbar, die fortlaufend Analysemethoden für die
Bestimmung in biologischem Material entwickelt, prüft und validiert. Für Glycerintrinitrat beispielsweise mussten die abgeleiteten Werte zurückgezogen werden, nachdem sich zeigte, dass kein valides Messverfahren vorliegt. Andererseits ermöglichen neue, validierte Analysemethoden die Ableitung von Beurteilungswerten für Substanzen, für die bisher aufgrund fehlender Beurteilungswerte kein Biomonitoring in der arbeitsmedizinischen Vorsorge durchgeführt werden konnte. Durch die Arbeit der BAT-Arbeitsgruppe kann bei Evaluierung einer unzureichenden Datenlage für die Ableitung von Beurteilungswerten die Durchführung von arbeitsmedizinischen Feldstudien angeregt werden.
Die Akzeptanz und die korrekte Anwendung der BAT-Werte in der Praxis sind entscheidend für deren Wirksamkeit. Welche Maßnahmen ergreift die BAT-Arbeitsgruppe, um sicherzustellen, dass die erarbeiteten Werte und ihre wissenschaftlichen Grundlagen von den Anwendenden – insbesondere in der Betriebsmedizin – verstanden und korrekt implementiert werden? Gibt es spezifische Herausforderungen bei der Vermittlung komplexer toxikologischer Konzepte an ein breiteres Publikum?
H. Drexler: Viele Informationen zum Biomonitoring, wie zum Beispiel der Probenahmezeitpunkt und die Matrix, finden sich in der MAK- und BAT-Werte-Liste, die jährlich erscheint. Die kritische Toxizität, die Halbwertszeit, die Hintergrundbelastung und weitere stoffspezifische Angaben sind in den jeweiligen Begründungen, die im Open Access bei Publisso abrufbar sind, ausführlich beschrieben. Mehrere Mitglieder der BAT-Arbeitsgruppe sind an der Überarbeitung der AMR (Arbeitsmedizinischen Regel) 6.2 beteiligt, die auch praktische Hinweise für die Durchführung des Biomonitorings gibt. Daneben referieren die Mitglieder der Arbeitsgruppe über das Thema auf Tagungen und in den Akademien für Arbeitsmedizin. Biomonitoring ist unser fachärztliches Instrument. Das zeigt sich immer wieder, wenn Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen Bestimmungen von Fremdstoffen in biologischem Material durchführen lassen und dann bei der Beurteilung mit verschiedenen Beurteilungswerten konfrontiert sind (HBM-Wert I und II – für die Allgemeinbevölkerung, unter anderem auch Kinder und Ältere und gegebenenfalls Schwangere – der Kommission Humanbiomonitoring des Umweltbundesamtes, Referenzwerte, BAT-Werte u. a.). Immer wieder werden auch Metallbestimmungen im Urin nach Mobilisierung mit Chelatbildnern durchgeführt, obwohl diese Ergebnisse diagnostisch nicht verwertbar sind. Der korrekte Einsatz des Biomonitorings und die Interpretation der Messergebnisse sind arbeitsmedizinisches Fachwissen.
In der BAT-Arbeitsgruppe werden unter anderem Grenzwerte (BAT-Werte, BLW) und Referenzwerte (BAR) abgeleitet. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Werten, und wie werden sie in der arbeitsmedizinischen Praxis genutzt, um Expositionen zu beurteilen und präventive Maßnahmen abzuleiten? Können Sie ein konkretes Anwendungsbeispiel nennen?
H. Drexler: Ein Referenzwert beschreibt die Belastung mit einem Arbeitsstoff in der beruflich nicht gegenüber diesem Arbeitsstoff exponierten Allgemeinbevölkerung im erwerbsfähigen Alter ohne Aussage zu gesundheitlichen Effekten. Beispielsweise lag der Referenzwert für Blei in den 1980er Jahren bei 300 µg/l Blut und damit doppelt so hoch wie der aktuelle BAT-Wert. Wenn bei beruflich Exponierten BAR überschritten werden, kann die Aussage gemacht werden, dass es zu einer zusätzlichen Belastung durch die Arbeit kommt. Ist dies nicht der Fall, so kann nach der AMR 11.1 beispielsweise bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen auf eine Pflichtvorsorge verzichtet werden. BAT-Werte werden gesundheitsbasiert am empfindlichsten, systemischen toxikologischen Endpunkt abgeleitet. Bei Einhaltung des BAT-Wertes wird die Gesundheit der Beschäftigten auch bei wiederholter und langfristiger Exposition im Allgemeinen nicht beeinträchtigt. Beispielsweise wurde der BAT-Wert für Blei in Höhe von 150 µg Blei/l Blut an den ersten nachweisbaren zentralnervösen Effekten (LOAEL – „lowest observed adverse effect level“ ≥ 180 µg/l Blut) abgeleitet. Weitere toxische Effekte (Beeinträchtigung der Spermienmotilität und der Blutbildung sowie Effekte auf die Nieren und das periphere Nervensystem) treten erst bei höheren Konzentrationen auf und sind bei Einhaltung des Grenzwertes nicht zu erwarten. Treten bei Überschreitung eines Grenzwertes Effekte auf, ist stets zu prüfen, ob diese durch die Exposition verursacht sein können. So kann beispielsweise eine Grenzwertüberschreitung für Blei nicht als Ursache einer Anämie angesehen werden, wenn die Bleikonzentration unter 500 µg/l liegt.
Ein großer Vorteil des Biomonitorings ist die Erfassung der tatsächlichen inneren Belastung des Menschen durch Arbeitsstoffe, unabhängig vom Aufnahmeweg. Inwieweit hilft dies die Gesamtbelastung der Beschäftigten zu bewerten, die auch Expositionen außerhalb des Arbeitsplatzes umfassen kann, und welche Rolle spielt die BAT-Arbeitsgruppe bei der Abgrenzung beruflicher von nicht-beruflicher Exposition?
H. Drexler: Um die nicht-berufliche Exposition gegenüber einem Arbeitsstoff zu beurteilen, findet sich in jeder Begründung ein Kapitel zur Hintergrundbelastung. Durch die Einführung des BAR für die Allgemeinbevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist es möglich geworden, zu beurteilen, ob eine zusätzliche berufliche Belastung gegenüber dem jeweiligen Arbeitsstoff vorliegt. Anders als bei den Referenzwerten für die Allgemeinbevölkerung muss aber auf den korrekten Probenahmezeitpunkt geachtet werden. Eine besondere Bedeutung hat der BAR für Blei bei Frauen. Weil die psychische Entwicklung des Ungeborenen durch Blei geschädigt wird, ohne dass dafür ein sicherer Schwellenwert formuliert werden kann, und Blei eine sehr lange Halbwertszeit im Körper hat, dürfen Frauen, die gebären können, durch die berufliche Tätigkeit nicht höher als die Allgemeinbevölkerung belastet sein.
Herr Professor Drexler, vielen Dank für die interessanten und erhellenden Ausführungen!
Kontakt
Prof. Dr. med. Hans Drexler
Arbeitsgruppe „BAT-Werte“ der Ständigen Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe