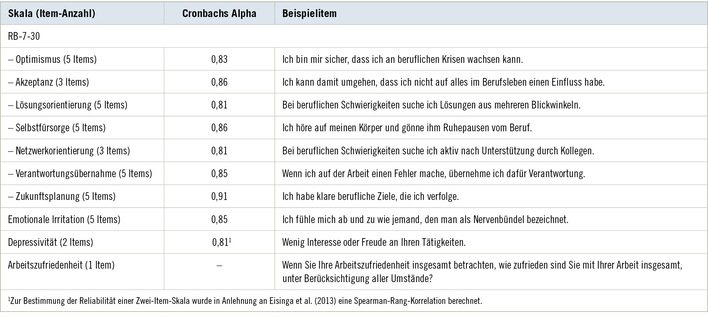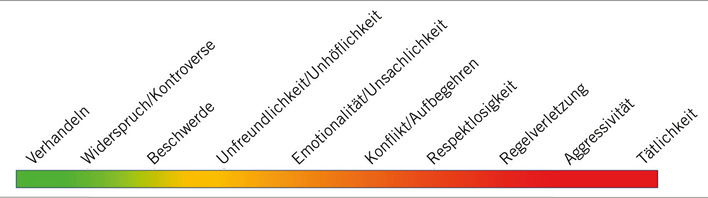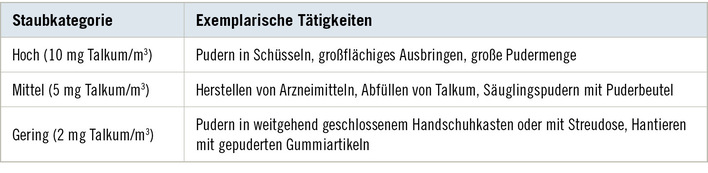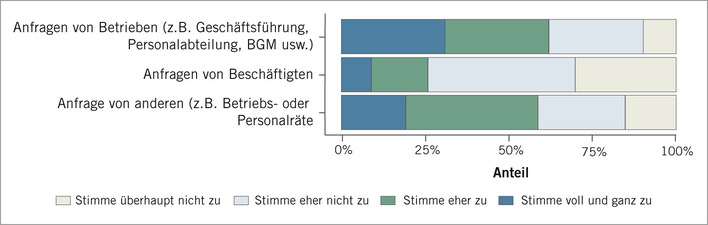Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Prevention with AI: the focus is on people
Artificial intelligence (AI) is finding its way into all areas – including occupational health and safety. Many applications are still in the development phase, but one thing is already clear: AI will only develop its full potential in interaction with humans.
Prävention mit KI: Mensch im Mittelpunkt
Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in alle Bereiche – auch im Arbeitsschutz. Viele Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklungsphase, doch eines ist bereits klar: Ohne die menschliche Komponente wird es auch künftig nicht gehen. Erst im Zusammenspiel mit dem Menschen entfaltet KI ihr volles Potenzial.
Kernaussagen
KI in Medizin und Arbeitsmedizin
KI ist in der Medizin längst etabliert. In der Krebstherapie werden heute Behandlungsverläufe und -ergebnisse digital dokumentiert, zusammengeführt und mittels KI auswertet. In dem EU-Projekt OPTIMA werden etwa gezielt Krebsbehandlungsdaten zusammengeführt, um daraus Therapieempfehlungen für Ärztinnen und Ärzte zu entwickeln – es basiert europaweit auf Daten von über 200 Millionen Menschen (s. Online-Quellen).
In der Arbeitsmedizin ermöglicht KI die Auswertung großer Datenmengen, etwa aus dem Monitoring von Vitaldaten durch sogenannte Wearables. Diese Gesundheitsdaten von tragbaren Geräten wie Smartwatches, Smartrings oder anderen Sensoren können in Echtzeit Daten erheben, um nach entsprechender Analyse präventive Maßnahmen individuell und zeitnah anzupassen.
Stärken und Grenzen der KI
Um zu verstehen, warum KI in der Prävention so mächtig – und gleichzeitig noch so limitiert – sein kann, hilft der Blick in die Arbeitsweise von KI. Dabei wird sehr schnell deutlich, dass es sich nicht um eine Intelligenz handelt, die vernetzt arbeitet und logische Zusammenhänge erkennt, sondern ausschließlich nach Wahrscheinlichkeiten agiert. Wer heute etwa eine Frage bei ChatGPT, Copilot oder einem anderen sogenannten Large-Language-Modell (LLM) eingibt, kann verfolgen, wie diese Systeme arbeiten: Das stückweise Vorgehen hat dabei nichts mit dem für menschliche Wesen typischen Nachdenken zu tun. Vielmehr prüft die KI, welches Wort am wahrscheinlichsten auf das vorherige folgt. Muss nach dem bestimmten Artikel „das“ der Begriff „Auto“ oder „Haus“ kommen? Aufgrund der enormen Datenmengen ist die Trefferquote dabei sehr hoch – auf der anderen Seite erklärt sich so allerdings auch das Phänomen des Halluzinierens der KI, womit eine überzeugend formulierte Antwort des LLM gemeint ist, die objektiv falsch sein kann.
Menschliche Kontrolle bleibt unerlässlich
KI-Systeme sind menschlichen Fähigkeiten überlegen, wenn es darum geht, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Je mehr Informationen die Modelle dabei zur Verfügung haben, umso sicherer werden die Antworten die Realität abbilden. So ist KI etwa in der Auswertung optischer Datenquellen schon heute aus der Medizin nicht mehr wegzudenken. Egal, ob es sich um Röntgenfotos subtiler Knochenbrüche, Bilder von Hautveränderungen oder seitenweise EKG-Scans handelt – sie können laut vieler Studien sicherer und effizienter von Computeralgorithmen als von menschlichen Expertinnen und Experten ausgelesen und gedeutet werden.
Doch trotz dieser Fortschritte bleibt menschliches Urteilsvermögen essenziell. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) betont, dass KI zwar Daten liefert, aber die Interpretation und Entscheidung über geeignete Maßnahmen weiterhin in menschlicher Hand liegen müssen.
Aspekte wie ethische Verantwortung, Empathie und Kontextverständnis sind für KI aktuell unerreichbar.
KI in der Gefährdungsbeurteilung: KICO – Risk Assessment
Ein praxisnahes Beispiel für KI im Arbeitsschutz ist KICO – Risk Assessment, entwickelt von BG prevent (vormals B·A·D) und Deep Care.
Mit KICO – Risk Assessment können Beschäftigte an jedem Bildschirmarbeitsplatz eigenständig eine rechtssichere Gefährdungsbeurteilung durchführen. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen im Homeoffice arbeiten, war dies bislang kaum möglich: Eine punktuelle Arbeitsplatzbegehung in Privaträumen ist weder wirtschaftlich sinnvoll, noch in größeren Umfang umsetzbar. Das Medium Video kommt für viele gerade bei diesem persönlich sensiblen Thema nicht infrage und eine fragebogenbasierte Risikobewertung ist fehleranfällig und zeitaufwändig. Bei KICO – Risk Assessment handelt es sich um ein Gerät – kaum größer als ein Smartphone – mit intelligenten Sensoren: Sie messen über 14 Tage hinweg äußere Einflüsse wie Licht und Lärm sowie Sitz- und Stehhöhen am Arbeitsplatz gemäß den Richtlinien zur Gefährdungsbeurteilung. Dies geschieht in Kombination mit einem interaktiven Fragenkatalog, durch den die Nutzerin oder der Nutzer intuitiv geführt wird.
Und wo steckt hier die KI? Sie ist die Basis: KICO – Risk Assessment ist „gefüttert“ mit unzähligen Datensätzen, zum Beispiel, wie eine ideale ergonomische Haltung am Schreibtisch aussehen sollte. KICO „weiß“, wie eine ideale Arbeitsumgebung gestaltet sein sollte, gleicht das mit den gesetzlichen Vorschriften ab und schlägt schließlich konkrete Maßnahmen vor (➥ Abb. 1). Diese sind in einem Ergebnisbericht enthalten, die die Beschäftigten dann an die Vorgesetzten oder die für Arbeitssicherheit zuständige Person im Betrieb weiterleiten kann. Gemeinsam mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit wird dann geprüft, welche Maßnahmen geeignet erscheinen beziehungsweise welche auf jeden Fall umgesetzt werden müssen, um den gesetzlichen Vorschriften zu genügen. Mithilfe der Technik wird so zum ersten Mal eine Gefährdungsbeurteilung einfach und unkompliziert machbar, wo es zuvor keine gute Möglichkeit gab, den gesetzlichen Vorgaben zu genügen.
Sensorik und KI im Arbeitsschutz
KI kann aber noch mehr. So kann etwa mithilfe spezieller Sensoren gewährleistet werden, dass Mitarbeitende ihre Schutzkleidung korrekt angelegt haben. Die Sensoren können auch melden, wenn sich die Person in einem Gefahrenbereich zu lange aufhält oder falsche Bewegungen vornimmt – alles Anwendungen, die im Arbeitsschutz dazu beitragen, Risiken frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen wie etwa die Umgestaltung von Gebäuden gezielt einzuleiten.
Virtual Reality und Augmented Reality in der Prävention
Auch VR und AR gewinnen im Arbeitsschutz an Bedeutung.
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hat ein AR-System zur Visualisierung von magnetischen Feldern am Arbeitsplatz entwickelt. Da diese Felder für Beschäftigte nicht wahrnehmbar sind, können Mitarbeitende nur schwer einschätzen, ob von bestimmten Betriebsmitteln eine Gefahr ausgeht. Die AR-Anwendung macht die Werte auf dem Smartphone sichtbar.
BG prevent wiederum setzt auf VR-Technologie: Der VR Fire-Trainer (➥ Abb. 2) ermöglicht realistische Brandschutzübungen – für eine besonders authentische Lernerfahrung.
Das System beinhaltet dabei mehr als eine VR-Brille. Zum einen wird mithilfe eines Trackers sehr präzise die Position des Nutzenden bestimmt. Mit ihm lassen sich sämtliche Bewegungen in einem vorgegebenen Bereich verfolgen. Wie im echten Leben muss bei der Übung mit einem Feuerlöscher agiert werden, digitale Sensoren an Lasche, Schlagbolzen und Düse lassen das Training äußerst realistisch erscheinen. Der Clou sind jedoch der Geruchssimulator sowie ein Wärmestrahler, die auf jede Bewegung der Nutzerin/des Nutzers während der Trainingssimulation reagieren. Realität und digitale Welt verschmelzen, für die Anwendenden ergibt sich ein sogenanntes immersives Erlebnis in 4D.
Die Zukunft der KI in der Prävention
Ob LLM, Sensorik, VR oder AR – KI wird in der Prävention eine zentrale Rolle spielen. Sie hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Gesundheit von Beschäftigten zu erhalten.
Die menschliche Komponente bleibt jedoch essenziell – sowohl bei der Interpretation von KI-Ergebnissen als auch für deren Akzeptanz. Eine repräsentative Umfrage der DGUV zeigt, dass Beschäftigte KI teils als Unterstützung sehen, teils aber Bedenken bezüglich Transparenz und Kontrolle haben. Vertrauen entsteht durch offene und transparente Kommunikation über den KI-Einsatz.
Interessenkonflikt: Beide Autoren sind bei der BG prevent GmbH beschäftigt. Weitere Interessenkonflikte liegen nicht vor.
Online-Quellen
Gross B: Möglichkeiten und Grenzen von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. DGUV Forum 3/2023
https://forum.dguv.de/ausgabe/3-2023/artikel/moeglichkeiten-und-grenzen…
DGUV Barometer Arbeitswelt 2025
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/dguv-barometer-arbeitswelt-2025-…
DGUV: Vertrauen in KI: Herausforderung und Chance für die Arbeitswelt, 2025
https://www.dguv.de/kompakt/ausgaben/2025-3/vertrauen-in-ki-herausforde…
Optima: Krebsbekämpfung durch Real-World-Daten und künstliche Intelligenz
https://www.optima-oncology.eu/

Foto: Christof Mattes
Tipps
Empfehlungen für die Implementierung von KI im eigenen Unternehmen
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: 39. Internationaler A+A Kongress 2025
Der Autor Thomas Auhuber ist wissenschaftlicher Leiter und Referent des 39. Internationalen A+A Kongresses, der vom 4. bis 7. November 2025 in Düsseldorf parallel zur A+A Leitmesse stattfindet.
Die Basi, Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e. V., organisiert diese Veranstaltung, die zu den wichtigsten der Branche weltweit zählt – mit aktuellen Themen rund um Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Weitere Infos: www.basi.de