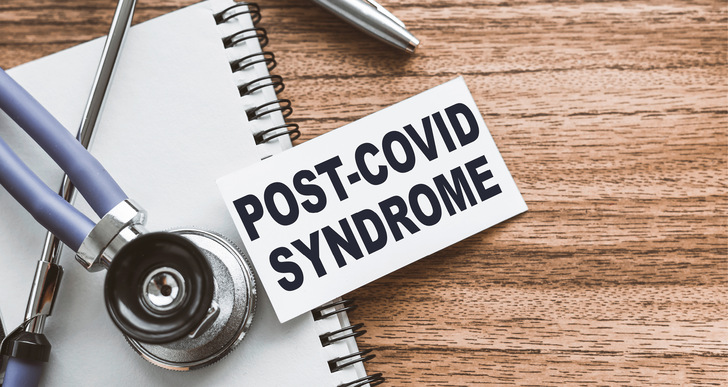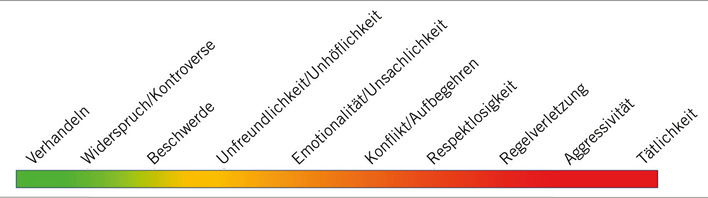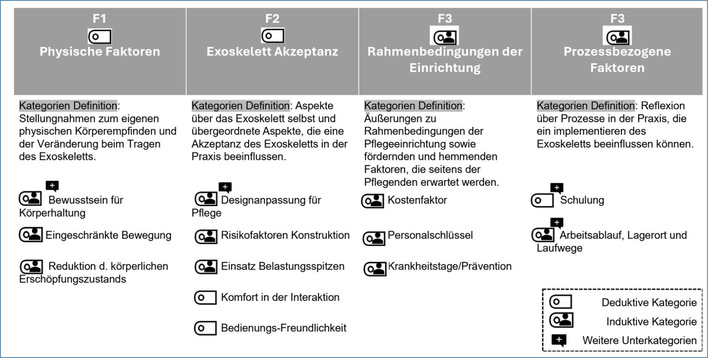Epidemiologie und gesellschaftliche Bedeutung
In Deutschland haben sich von 2020 bis Mai 2022 über 25 Millionen Menschen mit dem COVID-19-Virus infiziert. Hinzu kommt eine erhebliche Dunkelziffer. Ein Großteil der Infektionen verlief mild bis moderat. Häufiger und ausgeprägter als andere Viren bewirkt das SARS-CoV-2-Virus eine dysfunktionale Aktivierung des Immun- und Gerinnungssystems und wahrscheinlich auch Autoimmunphänomene. Neben einer schweren akuten Covid-19-Erkrankung können hieraus länger anhaltende Krankheitssymptome im Sinne eines Post-COVID-Syndroms die Folge sein. Etwa 5–10 % der Infizierten scheinen hiervon betroffen zu sein. Bei Patientinnen und Patienten, die stationär behandlungspflichtig oder gar beatmet waren, liegt diese Quote deutlich höher. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine vollständige Impfung auch vor einem Post-COVID-Syndrom schützt, allerdings lässt sich aus den aktuell zur Verfügung stehenden Daten noch nicht ableiten, wie ausgeprägt dieser Schutz ist. Unklar ist, wie sich die Omikron-Welle auf die Post-COVID-Häufigkeit auswirkt, weil die Nachbeobachtungszeit noch zu
kurz ist.
Laut Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung sind 303.267 Patientinnen und Patienten mit dem speziellen Post-
COVID-Abrechnungscode in den ersten drei Quartalen 2021 dokumentiert und behandelt worden, davon 19 % mit länger anhaltenden Beschwerden. In den Jahren 2020 und 2021 waren Corona-Infektionen die häufigsten anerkannten Berufskrankheiten – allein 2021 etwa 100.000 Fälle. Auch wenn Post-COVID nach diesen Zahlen nicht zur „neuen Volkskrankheit“ wird, wie in den Medien gelegentlich postuliert, wird es laut Expertenrat der Bundesregierung doch zu
einer langfristigen Belastung der Gesellschaft sowie des Gesundheits- und Sozialversicherungssystems führen und den Aufbau spezieller Versorgungsstrukturen erfordern. Hiervon werden auch die Arbeitswelt und die Arbeitsmedizin betroffen sein.
Definition
Zunächst wurden unterschiedliche Begrifflichkeiten für COVID-19-Folgezustände verwendet. Die WHO hat nun im Oktober 2021 auf einer Konsensuskonferenz Post-COVID-19 definiert:
Entscheidend für die Diagnose: Beeinträchtigung im Alltag
Einzelne Symptome persistieren häufig nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, ohne dass dies mit relevanten Funktionsbeeinträchtigungen verbunden ist. Es ist daher bedeutsam, dass die WHO solche Beeinträchtigungen der Alltagsfunktion für eine Post-COVID-Diagnose fordert. Dies entspricht auch den allgemeinen diagnostischen Kriterien der ICD-11. Von der Berücksichtigung des Beeinträchtigungskriteriums ist auch abhängig, wie hoch die Prävalenz des Post-COVID-Syndroms einzuschätzen ist. Einzelne, auch über sechs Monate nach der Infektion persistierende Symptome werden je nach Studie von über 20 % der Infizierten berichtet, allerdings ist dies für die Mehrzahl glücklicherweise nicht mit wesentlichen Beeinträchtigungen von Leistungsfähigkeit und Lebensqualität verbunden. Wenn eine längerfristige relevante Leistungseinschränkung als diagnostisches Kriterium für das Post-COVID-Syndrom gefordert wird, ist mit einer Prävalenz im einstelligen Prozentbereich aller Infizierten zu rechnen. Angesichts der hohen Zahl Infizierter würde allerdings auch eine Wahrscheinlichkeit von nur einem Prozent bedeuten, dass 300.000 Menschen von einem Post-COVID-Syndrom mit relevanten Leistungseinschränkungen betroffen sind. Weitere epidemiologische Forschung ist also dringend notwendig, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt abschätzen zu können.
Der Begriff Long-COVID wird für Symptome verwendet, die länger als vier, aber weniger als 12 Wochen nach der akuten Infektion persistieren. Er wird auch gebraucht, um anhaltende somatische Krankheitsfolgen wie zum Beispiel eine Lungenfunktionseinschränkung nach erheblicher entzündlicher Veränderung des Lungenparenchyms nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu beschreiben. Im Unterschied zu Post-COVID sind hier die anhaltenden Funktionseinschränkungen und die körperliche Symptomatik durch somatische Folgen von COVID-19 hinreichend erklärlich.
Das Post-COVID-Syndrom ist eine klinische Diagnose, die gestellt wird, wenn Erkrankte die typischen Symptome im Verlauf nach einer SARS-CoV-2-Infektion (auch asymptomatische Verläufe) beschreiben und diese nicht durch ein anderes Krankheitsbild oder eine manifeste Organschädigung erklärt werden kann. Die aktuelle Leitlinie (Koczulla et al. 2022) stellt ausdrücklich fest, dass weder durch eine einzelne Laboruntersuchung noch durch ein Panel an Laborwerten ein Post-COVID-Syndrom positiv diagnostiziert oder wahrscheinlich gemacht werden kann.
Ätiologische Konzepte und Risikofaktoren
Die Annahme, dass sich die Gründe, warum eine Krankheit auftritt, von den Gründen, warum sich Menschen nicht von ihr erholen, unterscheiden können, ist auch zur Erklärung des Post-COVID-Syndroms hilfreich. Die Ätiologie des chronischen Post-COVID-Syndroms ist noch unklar und weitaus komplexer als ein lineares Ursache-Wirkungs-Prinzip. Bei schweren COVID-19-Verläufen sind langdauernde Gewebsschädigung diverser Organsysteme naheliegend und auf somatischer Ebene werden eine Persistenz von Viren/Virenbestandteilen, chronische (Hyper-)Inflammation, Autoimmunphänomene, Dysfunktion des Nervensystems, Endothelschäden/endotheliale Dysfunktionen und Thromboembolie als relevante Faktoren gesehen (Koczulla et al. 2022). Außerdem gibt es geschlechterspezifische Merkmale in der Immunantwort, die dazu beitragen, dass Frauen häufiger an Post-COVID erkranken.
Um die anhaltenden Funktionseinschränkungen auch nach milden bis asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen hinreichend zu erklären, scheinen neben der Betrachtung somatischer Risikofaktoren (v. a. Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, Adipositas, kardiovaskuläre Vorerkrankungen) psychosoziale Faktoren, wie eine vorbestehende psychische Störung/Vulnerabilität (v. a. Depression) oder chronischer psychosozialer Stress – sowohl durch das Pandemiegeschehen als auch unabhängig hiervon – und ein dysfunktionales Krankheitsverhalten bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik eine wesentliche Rolle zu spielen.
Das multifaktorielle Krankheitsverständnis des Post-COVID-Syndroms integriert somatische Erklärungsansätze mit psychologischen und sozialen Aspekten. Bedeutsam für die Krankheitsverarbeitung sind Wechselwirkungsprozesse zwischen der emotionalen Reaktion auf das Krankheitsgeschehen (z. B. Ohnmachtserleben), damit einhergehende Gedanken (z. B. lösungsorientiert vs. katastrophisieren) und sich etablierenden Verhaltensweisen (z. B. dysfunktionales Schonverhalten oder Selbstüberforderung). Als Vulnerabilitätsfaktor kann beispielsweise eine vorbestehende depressive Störung wirken, die im Kontext der SARS-CoV-2-Infektion und den Pandemieeinschränkungen exazerbiert und Fatigue als eines der Post-COVID-Leitsymptome aufrechterhält.
Hier scheint das bei der Erklärung der Chronifizierung von Schmerzen bewährte Avoidance-Endurance-Modell (Hasenbring et al. 2009) ein hilfreicher Ansatz: Ein Teil der Betroffenen neigt entweder zu dysfunktionalem Durchhalteverhalten oder zu ausgeprägter Vermeidung; Letzteres aus Angst, durch Überlastung Schaden anzurichten. Vermeidungs- und Schonverhalten führt vor allem bei langen Liegezeiten durch Dekonditionierung zu einer Chronifizierung von Fatigue, Schwindel und Körpersymptomen. Umgekehrt kann ein „sich nicht abfinden können“ mit der Symptomatik und den vorübergehenden Leistungseinschränkungen dazu führen, dass Patientinnen und Patienten immer wieder über ihre Grenzen gehen und damit die Chronifizierung fördern.
Erschöpfung, Luftnot, Schlaf- und Konzentrationsstörungen gehören auch unabhängig von COVID-19 zu den häufigsten Allgemeinsymptomen überhaupt. Dies ist relevant, da auch das subjektive Erklärungsmodell der Beschwerden zur Verfestigung und Chronifizierung einer Post-COVID-Symptomatik beitragen kann. In einer populationsbasierten Kohortenstudie (N = 26.823)
zeigte sich zwar ein Zusammenhang der oben genannten Körpersymptome mit der Überzeugung, an COVID-19 erkrankt gewesen zu sein, nicht aber mit dem serologischen Testergebnis. Dieses war nur mit dem Symptom einer Geruchs- oder Geschmacksstörung assoziiert. Dieser Befund zeigt, dass die mediale Präsenz von COVID-19 Menschen dazu bringen kann, ihre Symptome vorschnell hierauf zu attribuieren. Eine gründliche ärztliche Anamneseerhebung und Untersuchung ist also auch notwendig, um zu verhindern, dass Symptome, die auf eine andere Krankheit zurückzuführen sind, fälschlicherweise dem Post-COVID-Syndrom zugeschrieben werden.
Das multifaktorielle Erklärungsmodell impliziert, dass bei jeder und jedem Erkrankten die auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren der Symptomatik individuell erfasst und in einem Behandlungsplan berücksichtigt werden müssen. Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Monaten immunologische Faktoren, eine dysfunktionale Aktivierung des Gerinnungssystems oder Endothelschäden als Mitursache der Symptomatik genauer erforscht werden und sich hieraus auch spezifische Behandlungsoptionen entwickeln lassen. Sowohl die bisherigen Befunde für ein multifaktorielles Erklärungsmodell als auch die Erfahrung mit Folgesymptomen nach anderen Viruserkrankungen sprechen jedoch eher dagegen, dass es eine einzige somatische Ursache gibt, die die Post-COVID-Symptomatik allein auslöst und aufrechterhält.
Arbeitsmedizinische Bedeutung des Post-COVID-Syndroms
Neben der Müdigkeit werden Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen als besonders belastend erlebt, vor allem, wenn die Betroffenen im Beruf diesbezüglich höhere Anforderungen erfüllen müssen. Studien zeigen, dass Personen, die sich von COVID-19 erholt haben, im Vergleich zu nicht infizierten Kontrollpersonen immer noch signifikante kognitive Defizite aufweisen. Eine genauere Analyse bestätigt die Hypothese, dass COVID-19 einen Einfluss auf die menschliche Kognition in mehreren Bereichen hat. Hier berichten ca. 38 % der COVID-19-Genesenen weiterhin über für sie alltagsrelevante kognitive Defizite (Grover et al. 2021). In der Anamnese und im ärztlichen Gespräch sind diese jedoch oft nicht beobachtbar und grob orientierende Tests wie der Mini-Mental-Status-Test sind meist unauffällig. Erst in einer differenzierten neuropsychologischen Leistungstestung zeigen sich dann oft erhebliche Defizite, die die Angaben der Betroffenen nachvollziehbar machen. Entsprechende Klagen der Patientinnen und Patienten sollten also immer ernst genommen und weiter abgeklärt werden.
Grundsätzlich begründet das Symptom „Fatigue“ allein keine funktionelle Leistungseinschränkung. Im gutachtlichen Kontext empfiehlt sich eine Unterscheidung zwischen „Fatigue“ als subjektivem Gefühl einer vorzeitigen Ermüdung mit resultierender Leistungsminderung, das anamnestisch oder mittels Fragebögen erfasst werden kann, und „Fatigability“ als einer objektiv mess- beziehungsweise nachweisbaren Minderung der motorischen und/oder kognitiven Performance (Tegenthoff et al. 2022).
Zur Basisdiagnostik empfiehlt die S1-Leitlinie (Koczulla 2022) nach der Anamnese und klinischen Untersuchung:
Nach der Basisdiagnostik sollte den Betroffenen zunächst ein abwartendes Vorgehen unter primärärztlicher Betreuung und Behandlung mit den unten genannten Maßnahmen empfohlen werden. Bei Warnhinweisen in der Basisdiagnostik sowie einer klinischen Verschlechterung sollte eine vertiefende Diagnostik und/oder eine Überweisung an Organspezialistinnen/-spezialisten beziehungsweise eine Post-Covid-Ambulanz angeboten werden. Als Warnhinweise gelten ein schlechter Allgemeinzustand, eine signifikante Gewichtsabnahme, unerklärliche oder neu aufgetretene neurologische Defizite/Auffälligkeiten, neue Schmerzsymptomatik, sich verschlechternde somatische oder psychische Befunde. Eine erhöhte Aufmerksamkeit und Prinzipien der psychosomatischen Grundversorgung zur Verhinderung einer Chronifizierung sollten bei folgenden Symptomen angewandt werden:
Therapie
Zur Therapie stellt die Leitlinie fest: „Die Therapie orientiert sich an den Symptomen. Für eine spezifische Therapie gibt es bislang noch keine wissenschaftlich belastbaren Belege.“ In den Medien wird zwar immer wieder über neue Therapieansätze berichtet, meist jedoch nur auf der Basis von Einzelfällen. Aktuell (Stand Mai 2022) gibt es jedoch keine evidenzbasierte Alternative zu einem symptomorientierten Vorgehen.
Aufklärung und Beratung: Von vorrangiger Bedeutung ist eine gute Aufklärung und Beratung. Erkrankte mit Post-COVID-Symptomatik sind nicht zuletzt durch die teilweise widersprüchlichen und dramatisierenden Berichte in den (sozialen) Medien stark verunsichert. Der ärztlichen Beratung kommt hierdurch ein besonderer Stellenwert zu. Nach unserer klinischen Erfahrung wird die ärztliche Beratung im persönlichen Gespräch mit der Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, von den allermeisten Betroffenen als Orientierung in der Informationsflut dankbar angenommen. Wichtig ist es, die Beschwerden ernst zu nehmen und ihre Glaubwürdigkeit zu versichern. Dies wird durch eine sorgfältige Anamnese mit körperlicher Untersuchung und diagnostischer Abklärung nach den oben genannten Grundsätzen vermittelt. Entscheidend ist, die Betroffenen dabei zu unterstützen, beim Zurückfinden in den Alltag nach der Infektion den für sie passenden Weg zwischen angstbedingter dysfunktionaler Schonung einerseits und zu hohen Ansprüchen an sich selbst andererseits zu unterstützen. Die Erholung von einer COVID-19-Infektion kann viel Geduld erfordern.
Bewegung: Moderates, an die eigenen Belastungsgrenzen angepasstes Ausdauertraining gehört zu den effektivsten Behandlungsmöglichkeiten bei Fatigue, zum Beispiel im Rahmen einer Tumorerkrankung oder eines
Fibromyalgiesyndroms. Inzwischen wurde in ersten Studien gezeigt, dass sich Ausdauertraining auch beim Post-COVID-Syndrom günstig auf Fatigue, Dyspnoe und Leistungsfähigkeit sowie psychische Symptome wie Angst auswirkt. Belege gibt es auch für einen direkten positiven Einfluss auf die SARS-CoV-2-induzierten angiologischen und immunologischen Veränderungen. Bei leicht- und mittelgradigen depressiven Symptomen ist regelmäßiges Ausdauertraining ähnlich wirksam wie ein Antidepressivum (Köllner u. Kleinschmidt 2021).
Bei der Beratung ist es wichtig, individuell zu berücksichtigen, ob die Betroffenen eher zu angstbedingter Vermeidung oder zur Selbstüberforderung neigen, um im Sinne eines „Pacings“ entsprechend kompensatorisch auf sie einwirken zu können. Bei ausbleibendem Fortschritt oder Komplikationen ist ein professionell begleitetes Training (z. B. Rehasport) sinnvoll. Hinweise zur Wiederaufnahme der Bewegung nach COVID-Infektion finden sich auf der Homepage des Deutschen Verbands für Gesundheitssport und Sporttherapie (www.dvgs.de). Ob beim Post-COVID-Syndrom das Phänomen einer nachhaltigen Verschlechterung nach Belastung (Post Exercise Malaise, PME) ein häufiges Phänomen ist, ist noch nicht empirisch belegt.
Kognitives Training: Über 38 % der Post-COVID-Erkrankten leiden an relevanten Aufmerksamkeitsstörungen und kognitiven Defiziten (Grover et al. 2021). Die mit 81 % häufigste kognitive Einschränkung ist „brain fog“, eine schnelle und vorzeitige geistige Erschöpfung, die auch bei nicht-hospitalisierten COVID-19-Erkrankten häufig auftritt. Die kognitiven Einschränkungen sind nicht so schwer ausgeprägt wie bei einer Demenz und können bei einer orientierenden neurologischen Untersuchung und
Anamnese schnell unterschätzt werden. Gerade bei kognitiv anspruchsvollen Berufen kann es aber zu massiven Beeinträchtigungen kommen. Deshalb sollten entsprechende Äußerungen ernst genommen und im Zweifelsfall neurologisch abgeklärt werden. Zur Therapie ist kognitives Training, möglichst 30–45 Minuten zweimal die Woche, mindestens 10–15 Sitzungen gesamt, indiziert. Dies wird sowohl in ergotherapeutischen als auch in neuropsychologischen Praxen angeboten. Als Selbsthilfeintervention steht auch eine vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderte App zur Verfügung (https://www.neuronation.com/)
Psychotherapie: Psychotherapie ist nicht nur zur Behandlung psychisch ausgelöster Symptome indiziert, sondern kann auch bei der erfolgreichen Bewältigung einer körperlichen Erkrankung hilfreich sein. Beim Post-COVID-Syndrom können beispielsweise Techniken aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) Betroffene bei der Adaptation an die oft für längere Zeit eingeschränkte Belastbarkeit unterstützen. Grundsätzlich ist Psychotherapie sowohl bei Problemen bei der Krankheitsverarbeitung als auch bei einer klinisch relevanten psychischen Komorbidität (v. a. Depression, Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörung) indiziert.
Atemtherapie: Hyperventilation und anderen dysfunktionale Atemmuster sind die häufigste Ursache von Dyspnoe im Rahmen des Post-COVID-Syndroms. Hie ist zunächst die Vermittlung atemberuhigender Techniken sinnvoll (z. B. 4711-Technik, Anleitung siehe „Weitere Infos“). Sollte dies nicht ausreichen, ist Atemtherapie in einer hierfür qualifizierten physiotherapeutischen Praxis oder in der Rehabilitation indiziert.
Ernährung: Patientinnen und Patienten, die länger auf einer Intensivstation behandelt werden mussten, haben oft in relevantem Ausmaß an Muskelmasse verloren. Bei ausgeprägten Geruchs- und Geschmacksstörungen sowie im Rahmen von Fatigue und Depression kann es zu Appetitverlust kommen. Größtes Problem ist daher die Unterernährung. Bei der Ernährungsberatung ist daher auf eine ausreichende Kalorienzufuhr ebenso zu achten wie auf eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Wirksamkeitsnachweise für eine bestimmte Diätform gibt es ebenso wenig wie für den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln.
Rehabilitation: Eine teilstationäre oder stationäre medizinische Rehabilitation sollte dann angeregt werden, wenn nach COVID-
19 krankheitsbedingt nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bestehen oder drohen, die der multimodalen ärztlichen und therapeutischen Behandlung bedürfen – wenn also ambulante Heilmittel zur Behandlung nicht ausreichen (Koczulla et al. 2021). Die Indikation zur Rehabilitation ist vor allem dann zu stellen, wenn länger dauernde Arbeitsunfähigkeit (> 6 Wochen) besteht oder es den Betroffenen nicht mehr gelingt, ihren Arbeitsanforderungen auf angemessene Weise gerecht zu werden. Vor allem bei kognitiven Defiziten versucht ein Teil der Betroffenen, dies durch längere Arbeitszeiten zu kompensieren – was insbesondere beim Homeoffice nicht selten unentdeckt bleibt. In der Folge kann es dann zu einem Teufelskreis aus Erschöpfung und kognitiven Einschränkungen kommen, der zu langfristiger Arbeitsunfähigkeit führen kann.
Sinnvoll ist eine interdisziplinär aufgestellte Rehabilitation (Kupferschmitt et al. 2022), in der Psychoedukation und -therapie, Bewegungstherapie, kognitives Training und Atemtherapie angeboten werden. Dies ist sowohl in der psychosomatischen als auch in somatischen Rehabilitationskliniken mit entsprechenden Konzepten möglich. In der psychosomatischen Rehabilitation steht mit fünf Wochen allerdings ein längeres Zeitfenster zur Verfügung, was bei den oft langwierigen Verläufen hilfreich sein kann. Als Erstdiagnose sollte im ärztlichen Befundbericht zum Rehaantrag die ICD-10-GM-Ziffer für Post-COVID (U09.9!) angegeben werden, damit eine Rehabilitationsklinik mit einem spezifischen Behandlungskonzept ausgewählt werden kann.
Fazit
Eine COVID-19-Infektion ist seit 2020 die mit Abstand häufigste anerkannte Berufskrankheit. Auch wenn hier noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, ist doch mit einer sechsstelligen Zahl an Betroffenen des Post-COVID-Syndroms zu rechnen. Dies ist von erheblicher Bedeutung auch für die Arbeitsmedizin hinsichtlich Arbeitsunfähigkeit, Produktivitätsausfällen, Wiedereingliederung, Rehabilitation und Begutachtung.
Von besonderer Bedeutung sind kognitive Beeinträchtigungen, die in einer differenzierten neuropsychologischen Testung nachweisbar sind und auch in der Rehabilitation im Vergleich zur körperlichen Symptomatik nur verzögert auf die Behandlungsmaßnahmen ansprechen.
Als effektivste Behandlungsmaßnahme sind ein rehabilitatives Vorgehen mit individuell angepasstem körperlichem Auftrainieren, Atemtherapie und kognitives Training, gegebenenfalls im Rahmen einer multimodalen ambulanten oder stationären Rehabilitation anzusehen. Es besteht erheblicher Bedarf hinsichtlich Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Konzepten zur Rehabilitation und zur beruflichen Wiedereingliederung.
Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.
Literatur
Grover S et al.: Fatigue, perceived stigma, self-reported cognitive deficits and psychological morbidity in patients recovered from COVID-19 infection. Asian J Psychiatry2021; 64: 102815.
Hasenbring MI, Hallner D, Rus AC: Fear-avoidance- and endurance-related responses to pain: development and validation of the Avoidance-Endurance Questionnaire (AE). Eur J Pain 2009; 13.6: 620–628.
Koczulla AR, Ankermann T, Behrends U et al.: S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID. AWMF online 2021 (https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-027l_S1_Post_COVID_Lon…).
Köllner V, Kleinschmidt J: Bewegung(stherapie) als Ressource in der Psychosomatischen Medizin. Ärztl Psychother 2021; 16: 150–155.
Kupferschmitt A, Etzrodt F, Kleinschmidt J, Köllner V: Nicht nur multimodal, sondern auch interdisziplinär: Ein Konzept für fächerbergreifende Zusammenarbeit
in der Rehabilitation des Post-COVID-Syndroms. Psychother Psych Med 2022; 72.
Tegenthoff M, Drechsel-Schlund C, Widder B: Neurologisch-psychiatrische Begutachtung des Post-COVID-Syndroms. Nervenarzt 2022; 1–8.
WHO: A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, October, 6th, 2021.
doi:10.17147/asu-1-216974
Weitere Infos
Revision der S1-Leitlinie Post-COVID (erscheint in Kürze)
Merkblatt des Deutschen Verbands für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V. (DVGS) zum Wiedereinstieg in die
Bewegung nach Covid-Infektion
https://dvgs.de/images/2022/06/DVGS_09_Long_Covid_Factsheet_.pdf
Atemtherapie
https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/stress/richtig-atmen-atemueb…
Kernaussagen
von Konzepten zur Rehabilitation und zur beruflichen Wiedereingliederung.
Koautorin und Koautor
Kontakt
Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.