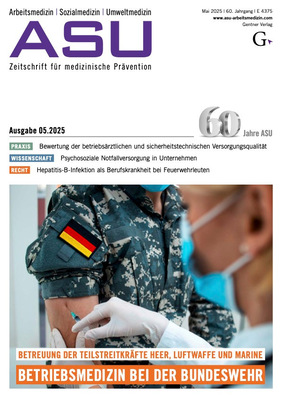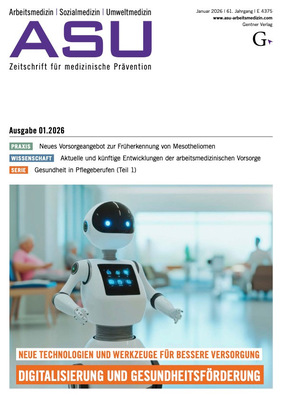Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Heute erreicht die Zeitschrift tausende Leserinnen und Leser im In- und Ausland: Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Personalverantwortliche und Unternehmerinnen/Unternehmer, die alle das Ziel eint, gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern. Wir gratulieren dem Redaktionsteam und allen Autorinnen und Autoren herzlich zu ihrem Engagement für ein Format, das mit seinen Inhalten über Jahrzehnte hinweg Akzente gesetzt hat.
Im Jahr 2025 müssen wir uns nun ehrlich fragen: Sind wir – mit unserem Knowhow, unseren Instrumenten und Methoden – schon da angekommen, wo wir angesichts der Dynamik in der Arbeitswelt sein sollten? Oder hält uns der Blick zurück auf bereits Erreichtes davon ab, mutig voranzugehen?
Die Arbeitswelt wandelt sich mit zunehmender Geschwindigkeit: neue Technologien, Digitalisierung, demografische Verschiebungen, klimabedingte Lebensweltveränderungen und ein tiefgreifender Wertewandel fordern uns heraus. Sind wir bereit, uns von alten Mustern zu verabschieden, Neues zu lernen und innovative Wege zu beschreiten?
Gerade die Digitalisierung eröffnet uns die Chance, Arbeitsmedizin zeitgemäß weiterzuentwickeln – vorausgesetzt, wir gestalten diesen Wandel aktiv mit. Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur, der Einsatz qualitativ hochwertiger Apps und digitaler Tools für Prävention und Beratung sowie die internationale Vernetzung sind dabei zentrale Bausteine. Sie bergen enormes Potenzial, stellen uns aber auch vor die Aufgabe, Schnittstellen nicht als Schwachstellen, sondern als Chancen für eine bessere Versorgung zu begreifen.
Dieses Heft zeigt, wie die Arbeitsmedizin das digitale Zeitalter nutzen kann: Es liefert Impulse, stellt Praxisbeispiele vor und lädt dazu ein, unsere Schlüsselrolle in den Betrieben Deutschlands neu zu definieren.
So berichtet Thomas Kraus im Interview mit Lukas Brethfeld über die Arbeit der Projektgruppe „Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin“ an mehreren neuen Regelwerken und zeigt Chancen und Herausforderungen digitaler Werkzeuge in der betriebsärztlichen Praxis auf – von Effizienzgewinnen bis hin zu den Hemmnissen für eine erfolgreiche Umsetzung.
Während softwaregestützte Dokumentationssysteme bereits Einzug in die arbeitsmedizinische Praxis gehalten haben, ist die Nutzung weiterer Systeme eher weniger verbreitet. Torsten Alles und David Bühne stellen in ihrem Beitrag das softwaregestützte Verfahren MARIE vor, mittels dessen Arbeitsbelastungen umfassend dargestellt und direkt mit den Fähigkeiten von Mitarbeitenden verglichen werden können – eine wichtige Hilfe in der betriebsärztlichen Praxis bei Eingliederungsfragen und der Suche nach Beschäftigungsalternativen.
Neben softwaregestützten Lösungen ist auf dem Markt inzwischen eine unüberschaubare Menge an Applikationen verfügbar. Mit seinem Beitrag bietet Lukas Brethfeld eine Orientierung und Einordnung der für die betriebsärztliche Praxis relevanten Apps und andere digitale Anwendungen an und zeigt Kriterien für Auswahl und Integration in die Praxis. In Teil 1 wird in dieser Ausgabe auf Lösungen für klassische Fragen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für die arbeitsmedizinische Praxis eingegangen.
Wie aber gelingt es, medizinisch fundierte, sichere und benutzerfreundliche Gesundheits-Apps von weniger geeigneten zu unterscheiden? Mit der Mobile Health App Database (MHAD) stellt die Arbeitsgruppe um Prof. Pryss (Michael Winter et al.) ihr wissenschaftliches Tool vor, das Transparenz für Qualität, Datenschutz und Wirksamkeit von Gesundheits-Apps schafft. (Speziell zum Thema „DIGA“ können Sie einen Beitrag in der kommenden Januar-Ausgabe von ASU lesen, die im Schwerpunkt zum Thema „Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin“ informieren wird.)
Es schließt sich die Analyse von Michael Drees hinsichtlich der Potenziale und Herausforderungen digitaler Selbst-Checks, medizinischer Scores und Wearables in der Arbeitsmedizin an, wobei er noch einmal auch die Eigenverantwortung der Beschäftigten in den Fokus stellt.
Thomas Nesseler betont in seinem Beitrag die Notwendigkeit der Anbindung der Arbeitsmedizin an die Telematik-Infrastruktur sowie den vollen Zugriff auf die elektronische Patientenakte (ePA) als wesentlichen Schlüssel für eine effektive und effiziente Gesundheitsversorgung in Deutschland, weil diese nur mir der Arbeitsmedizin und deren Zugang zum größten Präventionssetting – der Arbeitswelt – gelingen kann.
Im wissenschaftlichen Teil stellt die Nachwuchsgruppe BAKI (Betriebsärztliches Handeln: zukunftsorientiert, interdisziplinär und evidenzbasiert mit KI) um Frau Prof. Völter-Mahlknecht (Felix Leitner et al.) ihr im Rahmen des FoGA-Programms gefördertes Forschungsvorhaben vor, innovative digitale Lösungen für virtuell Beschäftigte zu finden. Mithilfe künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität sollen neue Wege der arbeitsmedizinischen Betreuung erschlossen werden.
Die Arbeitsgruppe um Frau Prof. Kaifie-Pechmann und Frau
Priv.-Doz. Dr. Morf (Anna Knoblich et al.) untersucht in ihrer Studie, ob die regelmäßige Nutzung der digitalen Gesundheitsanwendung Kaia Health im Vergleich zur Standardprävention zu Verbesserungen der Gesundheit bei Pflegekräften führt. Hierzu stellen sie ihr Studienprotokoll vor.
Jetzt ist die Zeit, die Weichen für die nächsten 60 Jahre voller innovativer und zukunftszugewandter Beiträge in der ASU zu stellen: Holen wir die Arbeitsmedizin ins digitale Zeitalter – nicht als Mitläuferin, sondern als Gestalterin gesunder Arbeitswelten!
Ihre Susanne H. Liebe
Präsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW)