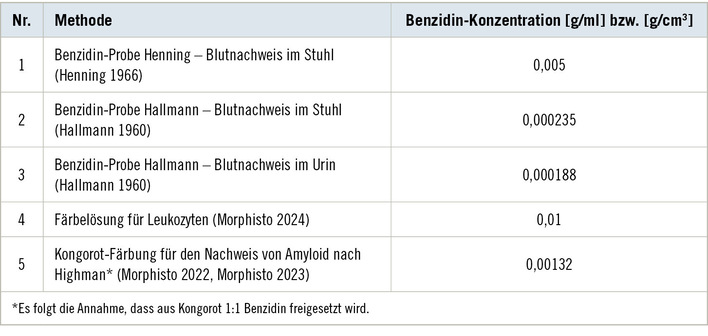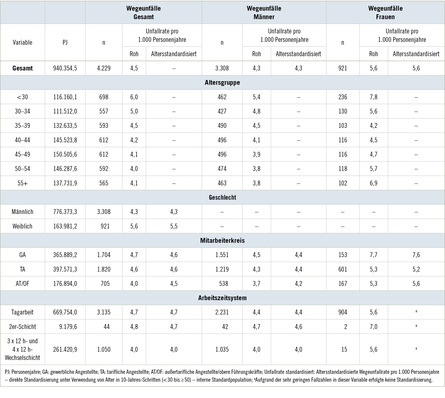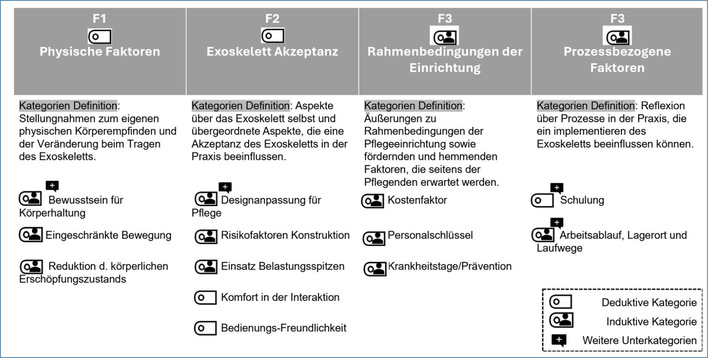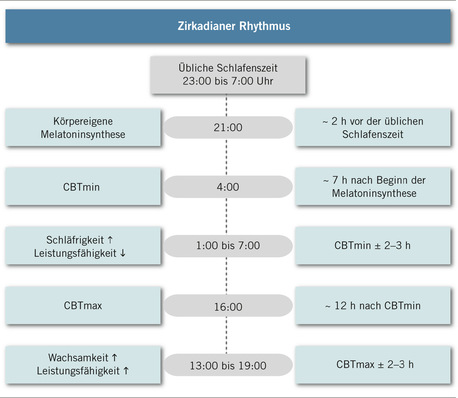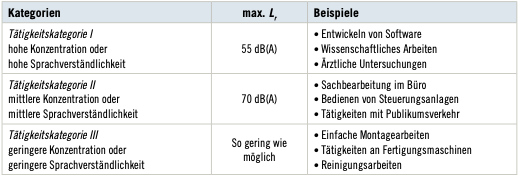Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Das Thema Wechseljahre ist in Deutschland noch immer stark tabuisiert, was sich auch am Arbeitsplatz widerspiegelt. Millionen erwerbstätiger Frauen sind täglich mit den Herausforderungen dieser natürlichen Lebensphase konfrontiert, oft ohne angemessene Unterstützung oder die Möglichkeit eines offenen Austauschs. Die Symptome – von Erschöpfung und Schlafstörungen bis hin zu Konzentrationsproblemen und Gelenkschmerzen – können die Arbeitsleistung erheblich beeinträchtigen. Betriebsärztinnen und -ärzte spielen eine Schlüsselrolle bei der Früherkennung und Sensibilisierung für dieses Thema. Es bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung, die medizinische und psychosoziale Aspekte berücksichtigt, sowie konkreter Unterstützungsmaßnahmen wie flexibler Arbeitsmodelle, gezielter Aufklärung und Führungskräfteschulungen. Susanne Liedtke zeigt in ihrem Beitrag an Beispielen einzelner Unternehmen, dass die Enttabuisierung der Wechseljahre nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist und zur Verbesserung der Mitarbeitergesundheit
und -bindung beiträgt.
Ergänzend hierzu liefert die wissenschaftliche Studie „Women in Change – Wechseljahre am Arbeitsplatz als arbeitsmedizinische Herausforderung mit besonderem Fokus auf Führungskräfte“ von Susanne Eble et al. neue Erkenntnisse. Die anonyme Online-Befragung von 821 weiblichen Führungskräften ergab, dass fast 70 % über menopausale Beschwerden berichteten. Davon gaben 50 % an, dass diese Symptome ihre berufliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Besonders häufig wurden kognitive Einschränkungen, emotionale Labilität und Fatigue genannt. Die Studie unterstreicht die arbeitsmedizinische Relevanz der Menopause, insbesondere bei weiblichen Führungskräften, und zeigt einen klaren Bedarf an betrieblicher Aufklärung, Enttabuisierung und struktureller Unterstützung im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung auf.
Endometriose betrifft weltweit etwa 190 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter und ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Die Teilhabe am Arbeitsleben hängt maßgeblich davon ab, wie gut die Arbeitsbedingungen zu den Erfordernissen der Erkrankung passen. Alexander Zill und Alexandra (Sasha) Cook zeigen in ihrer Studie, dass Endometriose-Betroffene ihre Arbeitsbedingungen hinsichtlich Führung und Stigmatisierung schlechter einschätzen als Beschäftigte mit anderen chronischen Erkrankungen. Sie berichten zudem häufiger über arbeitsbezogenes Burnout, Probleme bei der Erholung von der Arbeitstätigkeit und eine geringere Arbeitszufriedenheit. Die Erkrankung, oft begleitet von chronischen Beckenschmerzen und Müdigkeit, kann zu Produktivitätsverlusten führen. Organisationen sind aufgerufen, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Betroffene die Anforderungen ihrer Erkrankung und Arbeitsaufgaben bestmöglich bewältigen können, um Fachkräftemangel und Produktivitätsverlusten entgegenzuwirken.
Simone Davidsen, Gilles Bernard und Eva Maria Jabinger geben mit ihrer qualitativen Studie einen tiefen Einblicke in die subjektive Gesundheitswahrnehmung und -erfahrung von Frauen in Tirol. Die Interviews beleuchten Versorgungslücken, psychosoziale Belastungen und lebensphasenspezifische Herausforderungen. Frauen zeigen oft hohe Eigeninitiative im Umgang mit Beschwerden, erleben jedoch auch, dass ihre Anliegen bagatellisiert oder auf „hormonelle Ursachen“ reduziert werden, was zu Diagnose- und Therapieverzögerungen führen kann. Die Ergebnisse der Studie betonen die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Versorgung und der Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen. Sie liefern wichtige Anhaltspunkte für die Konzeption passgenauer Maßnahmen zur Stärkung der Frauengesundheit, indem sie die Perspektiven sichtbar machen, die in standardisierten Fragebögen oft unzureichend abgebildet werden.
Der Anteil von Frauen in landwirtschaftlichen Ausbildungsberufen und in der Grünen Branche insgesamt steigt kontinuierlich. Dies bringt spezifische Herausforderungen mit sich, insbesondere für schwangere und stillende Frauen, die besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Das Mutterschutzgesetz ist ein zentraler Bestandteil des Arbeitsschutzes und zielt darauf ab, die Gesundheit von Mutter und Kind am Arbeitsplatz zu schützen und Benachteiligungen zu verhindern. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und bei Bedarf Schutzmaßnahmen wie Umgestaltung des Arbeitsplatzes, Arbeitsplatzwechsel oder ein betriebliches Beschäftigungsverbot einzuleiten. Ina Siebeneich und Marion Baierl erläutertern, wie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit praxisorientierten Arbeitsschutzmaßnahmen und individuellen Leistungen, wie der Betriebs- und Haushaltshilfe, den Fortbestand landwirtschaftlicher Betriebe bei Ausfall von Landwirtinnen durch Schwangerschaft oder Mutterschutz gewährleistet.
Die Beiträge dieser Ausgabe verdeutlichen, dass die Frauengesundheit am Arbeitsplatz ein komplexes und vielschichtiges Thema ist, das weit über traditionelle Ansätze hinausgeht. Es erfordert ein Umdenken in Unternehmen und Gesellschaft, um genderspezifische Bedürfnisse und Herausforderungen sichtbar zu machen und ihnen proaktiv zu begegnen. Die Arbeitsmedizin spielt hierbei eine entscheidende Rolle – als Impulsgeberin, Beraterin und Vermittlerin. Indem wir das Tabu brechen und integrative, flexible sowie präventive Maßnahmen etablieren, können wir nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen im Berufsleben verbessern, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und Produktivität in deutschen Unternehmen leisten.
Ihre Simone Schmitz-Spanke
Chefredakteurin

Foto: DGAUM / Jürgen Scheere