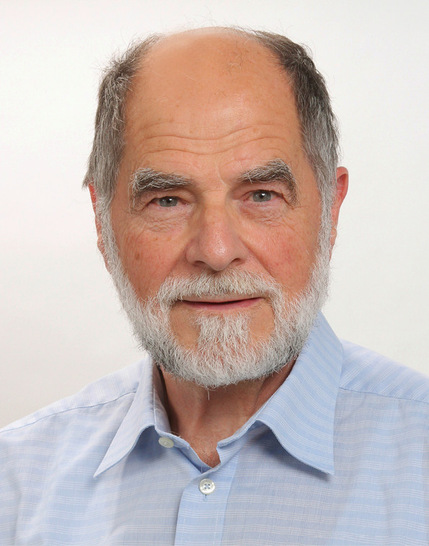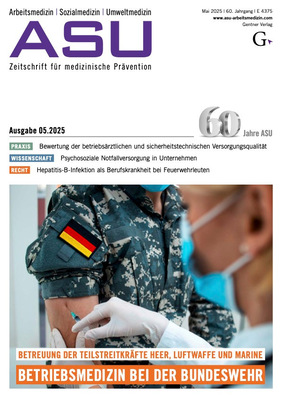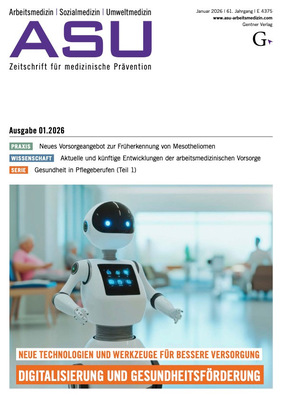Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
Im vorliegenden Sonderheft der ASU wird versucht, die Bandbreite dieser Themen in Bezug auf den Arbeitsschutz deutlich zu machen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Handwerk, insbesondere auch auf der Gebäudetechnik.
Abgesehen von Planungs- und Organisationstätigkeiten, sind Beschäftigte im Handwerk, insbesondere auch in der Gebäudetechnik, gewöhnlich hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Es kann sehr leicht zu Arbeitsunfällen kommen, aber auch Langzeitschäden durch arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten sind möglich. Häufige Unfälle sind:
Im Jahr 2023 wurden im Handwerk insgesamt etwa 220.000 meldepflichtige Unfälle gezählt. Das Handwerk ist hier Spitzenreiter im Vergleich zu allen anderen Branchen (etwa 6-mal so hoch). Das Nichttragen persönlicher Schutzausrüstungen kann kurz- und langfristige Folgen haben. Durch Heben, Tragen, Kraftausübung und hohe Bewegungsfrequenzen können Langzeitschäden des Muskel-Skelett-Systems entstehen. Die Situation und angepasste Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallschutz im Handwerk beleuchtet der Beitrag von Kurt Landau.
Trotz fortschreitender Digitalisierung – auch im Handwerk – steht die schwere körperliche Arbeit immer noch im Vordergrund. Das Heben schwerer Lasten, Krafteinsatz und ungünstige Körperhaltungen spielen bei der körperlichen Belastung die größte Rolle – und das oft bei widrigen physikalischen und chemischen Umgebungsbedingungen. Hitze, Kälte, Zugluft und Gefahrstoffe sind zu beachten. Zu der schweren körperlichen Belastung kommt immer mehr auch die psychische Belastung durch Termindruck, schwierige Auftraggeber, anspruchsvolle Informationstechnik oder bürokratische Hemmnisse. In vielen handwerklichen Berufen muss ein hoher Prozentsatz der Beschäftigten wegen dieser ungünstigen Belastungsbedingungen unter arbeitsbedingten Erkrankungen leiden oder gar vorzeitig in den Ruhestand gehen. Sind beim Arbeitgeber wenigstens Basiskenntnisse der ergonomischen Arbeitsgestaltung vorhanden, dann sollte Schritt für Schritt auch die Umsetzung in die tägliche Praxis gelingen. Die Bedeutung der ergonomischen Arbeitsgestaltung wird im Aufsatz von Kurt Landau aufgegriffen.
Exoskelette gibt es als Orthesen, also Stützkorsette, schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in der Rehabilitation. Im folgenden Beitrag von Kurt Landau geht es aber um die Anwendung von Exoskeletten durch Beschäftigte bei der Arbeit. Exoskelette kombinieren maschinelle Kräfte mit der Kreativität und der Sensumotorik des Menschen. Man erhofft sich durch Exoskelette
Im Bauhandwerk und speziell in der Gebäudetechnik erwartet man die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Reduktion von körperlichen Überlastungen, zum Beispiel beim Heben und Tragen oder bei den Überkopfarbeiten und einen Rückgang der Fehlzeiten. Diesen Hoffnungen stehen allerdings kritische Rückmeldungen aus der Praxis gegenüber.
An dieser Stelle sei auch auf das ASU-Themenheft vom Juli 2025 verwiesen, das sich mit Exoskeletten in der betrieblichen Anwendung detailliert auseinandersetzt.
Arbeitsunfälle an Füßen/Knie sind häufig. Um Verletzungen zu vermeiden, müssen je nach Tätigkeit passende Berufs-, Schutz- oder Sicherheitsschuhe getragen werden. Die Auswahl richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung (z. B. Durchtrittschutz auf Baustellen, Rutschhemmung in Küchen). Schutzklassen (S1, S2, S3) und Zusatzanforderungen (z. B. antistatisch, wasserdicht) sind zu berücksichtigen. Passform und Tragekomfort sind wichtig, Nutzende sollten in die Auswahl einbezogen werden. Einen informativen Überblick zu den Berufs-, Schutz- und Sicherheitsschuhen gibt der Aufsatz von Martin Schmauder.
Martin K. Riedel, Leiter des Gesundheitsmanagements eines Großunternehmens in der Automobilindustrie und Ärztlicher Koordinator Reisemedizin/medizinisches Krisenmanagement, berichtet im folgenden Interview von aktuellen Entwicklungen im Reiserisikomanagement, betrieblichen Impfstrategien und die Rolle der Arbeitsmedizin hierbei heute und in Zukunft.
Technologische Entwicklungen wie Digitalisierung und Automatisierung bieten nicht nur neue Chancen, sondern bergen auch neue Risiken. Arbeitsprozesse verändern sich, psychische Belastungen nehmen zu, neue Gefahrenquellen entstehen. Die Gefährdungsbeurteilung (GBU) psychischer Belastungen ist entscheidend für die Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Der Beitrag von Laura Reczek erläutert die rechtlichen Grundlagen und den standardisierten Prozess der GBU bei einem Produktionsunternehmen aus Chemie und Pharmazie. Die Ausführungen zur psychischen Belastung und die Arbeitsschritte zur Umsetzung in die Betriebspraxis können jedoch auch auf Handwerksbetriebe übertragen werden. Durch die Einbindung der Mitarbeitenden in alle Schritte wird sichergestellt, dass ihre Perspektiven und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dabei erfordern Besonderheiten im Produktionsumfeld spezifische Anpassungen im GBU-Prozess, die als Praxisempfehlungen in diesem Beitrag aufgegriffen werden.
Die visuelle Leistungsfähigkeit stellt eine zentrale Voraussetzung für sicheres und effizientes Arbeiten dar und ist somit ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Im Beitrag von Philipp Haß wird gezeigt, wie vielfältig Sehfunktionen die Arbeitsleistung beeinflussen und warum regelmäßige Sehtests ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Gesundheitsvorsorge sein sollten.
Es folgt ein Interview mit Stefan Brück, CEO eines Unternehmens, das maßgeschneiderte Lösungen für Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) anbietet. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz bei PSA und setzt auf eigene Fertigung und Nachhaltigkeit. Zentrale Trends sind Komfort, Funktionalität, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Individualisierte PSA-Lösungen werden branchenübergreifend immer wichtiger. Praxis-Feedback fließt direkt in die Produktentwicklung ein; Kooperationen mit Forschungseinrichtungen sichern Innovation. Der demografische Wandel erfordert ergonomische Lösungen. Das Unternehmen sieht Kreislaufwirtschaft und Prävention als künftige Schwerpunkte. Das Ziel ist optimaler, motivierender Schutz für Beschäftigte.
Arbeitsschutz im Unternehmen ist also bedeutend mehr als das Umsetzen lästiger und bürokratischer Artikelverordnungen der Europäischen Union. Es geht um die Verantwortung für Arbeitspersonen im Betrieb, um Innovationskraft und um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Arbeitsschutz ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und damit eine Investition in die wertvollste Ressource eines Unternehmens.
Ihr Kurt Landau