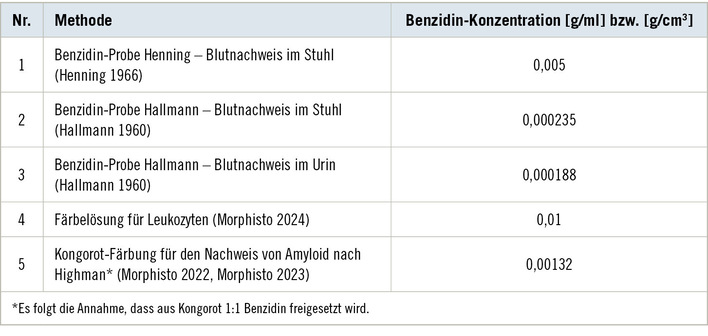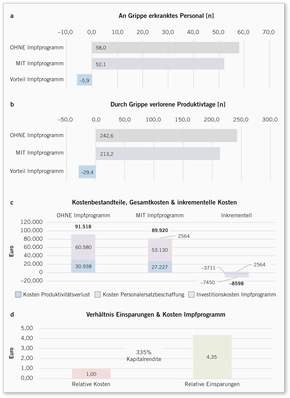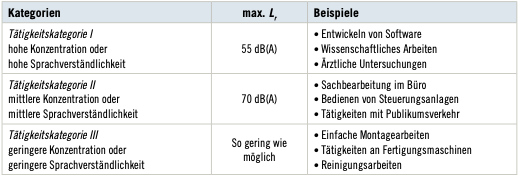Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
In unserer Serie „70 Jahre MAK-Kommission“ werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben die verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission vorstellen. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erfahren Sie, wie die MAK-Kommission auch heute noch eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Arbeitswelt von morgen sicherer und gesünder zu gestalten.
In der vierten Folge der Interview-Reihe beschreibt Frau Dr. Schriever-Schwemmer, kommissarische Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Entwicklungstoxizität“ der MAK-Kommission, wie deren Arbeit dazu beiträgt, ungeborene und junge Leben vor den Auswirkungen von Arbeitsstoffen zu schützen.
70 Years of the MAK Commission: Paving the way for healthy workplaces (Part 4): Insights into the developmental toxicity working group
In the following interview, Dr. Gerlinde Schriever-Schwemmer describes the principles and procedures for assessing the develpmental effects of occupational substances and explains the existing system of pregnancy risk groups.
70 Jahre MAK-Kommission: Wegbereiter für gesunde Arbeitsplätze (Teil 4): Einblicke in die Arbeitsgruppe „Entwicklungstoxizität“
Im folgenden Interview beschreibt Frau Dr. Gerlinde Schriever-Schwemmer Grundlagen und Vorgehensweise zur Bewertung der fruchtschädigenden Wirkung von Arbeitsstoffen und erläutert das bestehende System der Schwangerschaftsgruppen.
Frau Dr. Schriever-Schwemmer, Ihre Arbeitsgruppe befasst sich mit der Entwicklungstoxizität, einem Bereich, der besonders sensible Phasen des menschlichen Lebens berührt. Können Sie uns die spezifische Aufgabe Ihrer AG innerhalb der Senatskommission erläutern und wie Ihre Arbeit dazu beiträgt, ungeborene und junge Leben vor den Auswirkungen von Arbeitsstoffen zu schützen, insbesondere im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der MAK-Kommission?
G. Schriever-Schwemmer: Die MAK- und BAT-Werte gewährleisten den sicheren Schutz der Beschäftigten. Im Falle einer Schwangerschaft bedeutet die Einhaltung von MAK- und BAT-Werten jedoch nicht in jedem Fall den Schutz des ungeborenen Kindes, da dieser Endpunkt bei der Ableitung nicht berücksichtigt wird. Die Kommission überprüft daher alle Arbeitsstoffe daraufhin, ob eine entwicklungstoxische Wirkung anzunehmen ist und ordnet die Substanzen bestimmten Schwangerschaftsgruppen zu. Die Schwangerschaftsgruppen A, B und C sind risikobasierte Gruppen, das heißt, es wird eine Aussage darüber getroffen, ob die Einhaltung des MAK- oder BAT-Wertes den Schutz des ungeborenen Kindes gewährleisten kann.
In der Regel erfolgt die Beurteilung der entwicklungstoxischen Eigenschaften von Arbeitsstoffen überwiegend auf Grundlage von tierexperimentellen Studien. Um Unsicherheiten in der Bewertung der Tierversuche zu berücksichtigen, muss ein ausreichender Abstand zwischen dem MAK- oder BAT-Wert und dem NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) für Entwicklungstoxizität gegeben sein. Dieser Abstand ist abhängig von vergleichenden toxikokinetischen Daten bei Mensch und Tier und vom toxikokinetischen Verhalten eines Stoffes beim Muttertier und bei Embryonen/Föten. Liegen solche Daten nicht vor, spielt die Beurteilung spezifischer Stoffeigenschaften wie Molekülgröße, Lipidlöslichkeit und Proteinbindung eine wesentliche Rolle. Diese bestimmen den Übergang des Stoffes von der Mutter auf den Embryo/Fötus und damit die innere Belastung des Embryos/Fötus. Wichtige Faktoren sind auch Art und Schweregrad der beobachteten Befunde. Schwerwiegende Effekte, wie das vermehrte Vorkommen spezifischer Fehlbildungen bei Dosierungen ohne gleichzeitige maternale Toxizität, sind stärker zu berücksichtigen als eher transiente unspezifische beziehungsweise weniger schwerwiegende fötotoxische Effekte (wie geringfügig verringertes fötales Körpergewicht oder verzögerte Skelettreifung).
Die Bewertung der Entwicklungstoxizität und Reproduktionstoxizität von Substanzen ist eine komplexe wissenschaftliche Aufgabe. Welche experimentellen Ansätze und Datenquellen nutzt Ihre Arbeitsgruppe, um diese Effekte zu bewerten, und welche besonderen Herausforderungen ergeben sich dabei, beispielsweise bei der Extrapolation von Tiermodellen auf den Menschen oder der Berücksichtigung von Kombinationswirkungen?
G. Schriever-Schwemmer: Als
Datenquellen werden vorwiegend Literaturdatenbanken verwendet. Basis für die Bewertung sind epidemiologische und tierexperimentelle Studien, für den Wirkungsmechanismus auch In-vitro-Studien. Eine besondere Herausforderung bei der Extrapolation ist die Berücksichtigung des möglicherweise unterschiedlichen Metabolismus beziehungsweise toxikokinetischen Verhaltens von Stoffen beim Versuchstier im Vergleich zum Menschen. So wurden zum Beispiel für Methoxyessigsäure, die bei einem BAT-Wert von 15 mg/g Kreatinin der Schwangerschaftsgruppe B zugeordnet ist, komplexe toxikokinetische Überlegungen und Berechnungen vorgenommen, die zur Vergabe eines Hinweises auf Voraussetzung für Schwangerschaftsgruppe C führten. Das ist möglich gewesen, da die Eliminationshalbwertszeit beim Menschen im Vergleich zur Ratte bekannt ist (Hartwig u. MAK-Kommission 2025; Michaelsen et al. 2024).
Im Allgemeinen wird der Stoff selbst bewertet. Wenn der Stoff eindeutig nicht selbst, sondern mittels der Metaboliten wirkt, werden Daten von Metaboliten zur Bewertung herangezogen. Beispielsweise liegen für Benzylformiat keine Daten zur Entwicklungstoxizität vor. Im Organismus wird der Stoff hydrolytisch schnell und vollständig in Ameisensäure und Benzylalkohol gespalten. Informationen zu diesen beiden Stoffen sowie der Vergleich zum analogen Stoff Benzylacetat haben die Zuordnung zu Schwangerschaftsgruppe C bei einem MAK-Wert von 5 ml/m3 ermöglicht.
Kombinationswirkungen können auftreten, wenn gleichsinnige Wirkungen von verschiedenen Stoffen zu erwarten sind. Dies ist der Fall bei Isofluran und Sevofluran, bei denen von einem ähnlichen Wirkungsmechanismus auszugehen ist. Im Allgemeinen sind Kombinationswirkungen aufgrund der Komplexität schwierig zu bewerten.
Die Erkenntnisse Ihrer AG sind entscheidend für die Ableitung von Schutzmaßnahmen. Wie fließen die Ergebnisse Ihrer Bewertungen in die Festlegung von MAK-Werten ein und welche spezifischen Empfehlungen spricht Ihre Arbeitsgruppe aus, um beispielsweise schwangere oder stillende Arbeitnehmerinnen sowie generell Personen im reproduktiven Alter zu schützen?
G. Schriever-Schwemmer: Wie bereits erläutert, wird die fruchtschädigende Wirkung nicht zur Ableitung von MAK- und BAT-Werten herangezogen. Die Arbeitsgruppe bewertet auch Effekte auf die Reproduktionsorgane und die Fertilität, die bei der Ableitung der Grenzwerte berücksichtigt werden. Spezifische Empfehlungen werden zum Beispiel dann gegeben, wenn der Arbeitsstoff bestimmte Eigenschaften wie eine gute Hautgängigkeit besitzt. Auf die Vermeidung von Hautkontakt mit diesen Stoffen wird in einem solchen Fall in den Begründungen explizit hingewiesen. Beispiele dafür sind N,N-Dimethylformamid (Hartwig u. MAK-Kommission 2016a, 2017a) und Dimethylsulfoxid (Hartwig u. MAK-Kommission 2016b, 2017b). Auch bei besonders toxischen Arbeitsstoffen wie Blei, das der Schwangerschaftsgruppe A bei einem BAT-Wert von 150 µg/l Blut zugeordnet ist, wird darauf hingewiesen, dass eine zusätzliche Bleiexposition von Schwangeren und Frauen im gebärfähigen Alter über die Hintergrundbelastung hinaus mit einem zusätzlichen Gesundheitsrisiko des Ungeborenen verbunden ist.
Entwicklungstoxizität kann durch verschiedene Expositionspfade und unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Wie kooperiert Ihre AG mit anderen Arbeitsgruppen der Senatskommission, wie der AG Luftanalysen, der AG Hautresorption oder der AG Epidemiologie und Statistik, um ein möglichst umfassendes Bild der Risiken zu erhalten und die Schutzmaßnahmen optimal aufeinander abzustimmen?
G. Schriever-Schwemmer: Am Arbeitsplatz kommt der inhalativen Aufnahme eines Stoffes die größte Bedeutung zu, daneben spielt noch die dermale Aufnahme eine Rolle, besonders wenn der Stoff gut hautgängig ist. Im Falle einer guten Hautgängigkeit werden die Daten in der AG Hautresorption zusammengetragen und bewertet. Daraus resultiert dann für die AG Entwicklungstoxizität eine prozentuale Aufnahme durch die Haut, die entsprechend bei der Bewertung berücksichtigt wird. Die AG Luftanalysen und die AG Analysen im biologischen Material werden gegebenenfalls kontaktiert, wenn Messungen des Arbeitsstoffes in Veröffentlichungen auf ihre Validität geprüft werden müssen. Dies ist ein wichtiger Baustein bei der Beurteilung der Studienqualität. Die AG Epidemiologie und Statistik wird dann um Unterstützung gebeten, wenn es darum geht, die Validität einer epidemiologischen Studie zu bewerten. So sind beispielsweise Studien zu Vanadium diskutiert und Limitierungen, wie eine geringe statistische Power aufgrund kleiner Kollektive, identifiziert worden (Hartwig u. MAK-Kommission 2023).
Die Arbeitswelt ist einem ständigen Wandel unterworfen, und es kommen immer wieder neue Substanzen und Technologien zum Einsatz. Welche neuen Herausforderungen sehen Sie für Ihre Arbeitsgruppe in den kommenden Jahren?
G. Schriever-Schwemmer: Eine besondere Herausforderung wird die Bewertung der Ergebnisse aus In-vitro- und In-silico-Untersuchungen sein. Eine Eigenschaft, die sich für einen Stoff aus diesen Versuchen herausstellt, muss sich nicht in vivo bestätigen. Hierbei ist ein wichtiger Aspekt das toxikokinetische Verhalten eines Stoffes, was in den In-vivo-Versuchen am Tier beinhaltet ist. Dies fehlt jedoch bei den In-vitro- und In-silico-Untersuchungen und müsste dann entsprechend durch Modellierungen und Expert-Judgement aufgefangen werden.
Zurzeit sind für die Bewertung des entwicklungstoxischen Potenzials einer Substanz In-vivo-Daten aus Human- und/oder Tierstudien erforderlich. Dabei können kritische Zielorgane und komplexe multiple Wirkungen identifiziert werden. Darüber hinaus wird die Erstellung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und gegebenenfalls die Ableitung einer niedrigsten adversen Effektdosis ermöglicht.
Die Kommunikation von Risiken im Bereich der Reproduktions- und Entwicklungstoxizität ist besonders sensibel. Wie stellt Ihre Arbeitsgruppe sicher, dass die wissenschaftlich fundierten Ergebnisse verständlich und verantwortungsvoll an die Öffentlichkeit, an Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Arbeitgeber kommuniziert werden? Welche ethischen Überlegungen spielen dabei eine Rolle?
G. Schriever-Schwemmer: Bei der Erstellung der MAK- und BAT-Begründungen wird darauf geachtet, dass die Datenlage und vor allem die Schlussfolgerungen dazu verständlich und transparent umgesetzt sind. Dies gilt auch für Poster, die auf einer Tagung der DGAUM (Deutsche Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin) oder der DGPT (Deutsche Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie) gezeigt werden. Am Arbeitsplatz mit einer möglichen Exposition gegen gesundheitsgefährdende Stoffe gilt es nicht nur, Schaden von der Beschäftigten abzuwenden, sondern eben auch ein besonderes Augenmerk auf das Ungeborene zu richten. Gerade im Hinblick auf den bekannten teratogenen Schaden im Arzneimittelbereich durch Thalidomid in den 60er Jahren, ist der Schutz des Ungeborenen sehr stark in den Fokus gerückt.
Liebe Frau Dr. Schriever-Schwemmer, vielen Dank für Ihre ausführlichen und aufschlussreichen Antworten!
Literatur
Blei
Greiner A, Michaelsen S, Lohmann R, Weistenhöfer W, Schwarz M, van Thriel C, Drexler H, Hartwig A, MAK Commission: Blei und seine anorganischen Verbindungen (außer Bleiarsenat und Blei chromat) – Addendum: Evaluierung eines BAT Wertes. Beurteilungswerte in biologischem Material. MAK Collect Occup Health Saf 2022 7: Doc034. https://doi.org/10.34865/bb743992d7_2ad (Open Access).
DFG 2025
DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-Liste 2025. German Medical Science | PUBLISSO 2025. doi:10.34865/mbwl_2025_deu (Open Access).
N,N-Dimethylformamid
Hartwig A, MAK Commission: N,N-Dimethylformamid. MAK Value Documentation. MAK Collect Occup Health Saf 2016a; 1: 995–1007. doi:10.1002/3527600418.mb6812d0060 (Open Access).
Hartwig A, MAK Commission: N,N-Dimethylformamid. MAK Value Documentation. MAK Collect Occup Health Saf 2017a; 2: 122–123. doi:10.1002/3527600418.mb6812d0062 (Open Access).
Dimethylsulfoxid
Hartwig A; MAK Commission: Dimethylsulfoxid. MAK Value Documentation. MAK Collect Occup Health Saf 2016b; 1: 1: 1899–1903. doi:10.1002/3527600418.mb6768d0061 (Open Access).
Hartwig A, MAK Commission: Dimethylsulfoxid. MAK Value Documentation. MAK Collect Occup Health Saf 2017b; 2: 124–125. doi:10.1002/3527600418.mb6768d0062 (Open Access).
Methoxyessigsäure
Hartwig A, MAK Commission: 2-Methoxyethanol. MAK-Begründung, Nachtrag. MAK Collect Occup Health Saf 2025 10: Doc007. https://doi.org/10.34865/mb10986d10_1ad (Open Access).
Michaelsen S, Bartsch R, Brinkmann B, Schriever-Schwemmer G, Drexler H, Hartwig A, MAK Commission: 2-Methoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, Methoxyessigsäure, Diethylenglykoldimethylether, Diethylenglykolmonomethylether – Addendum: Evaluierung einer Schwangerschaftsgruppe zu den BAT-Werten mit dem Parameter Methoxyessigsäure. Beurteilungswerte in biologischem Material. MAK Collect Occup Health Saf 2024; 9: Doc017. https://doi.org/10.34865/bb62545d9_1ad (Open Access).
PCB
Brinkmann B, Bartsch R, Schriever-Schwemmer G, Drexler H, Hartwig A, MAK Commission: Addendum to Chlorinated Biphenyls BAT Value Documentation in German language. 2019. doi:10.1002/3527600418.bb133636d0024 (Open Access).
Hartwig A, MAK Commission: Chlorierte Biphenyle. MAK-Begründung, Nachtrag. MAK Collect Occup Health Saf 2025; 10: Doc005. https://doi.org/10.34865/mb0cbphpcbd10_1ad (Open Access).
Toluol
Hartwig A, MAK Commission: Toluol. MAK‑Begründung, Nachtrag. MAK Collect Occup Health Saf 2021; 6: Doc079. doi:https://doi.org/10.34865/mb10888d6_4ad (Open Access).
Weistenhöfer W, Schriever-Schwemmer G, Drexler H, Hartwig A, MAK Commission: Toluol – Addendum: Evaluierung einer Schwangerschaftsgruppe zu den BAT-Werten. Beurteilungswerte in biologischem Material. MAK Collect Occup Health Saf 2021; 6: Doc088. https://doi.org/10.34865/bb10888d6_4ad (Open Access).
Vanadium