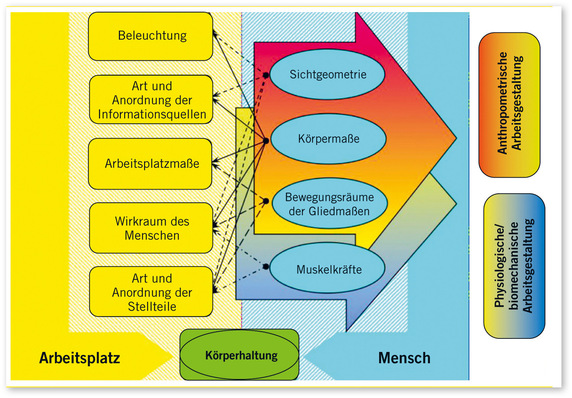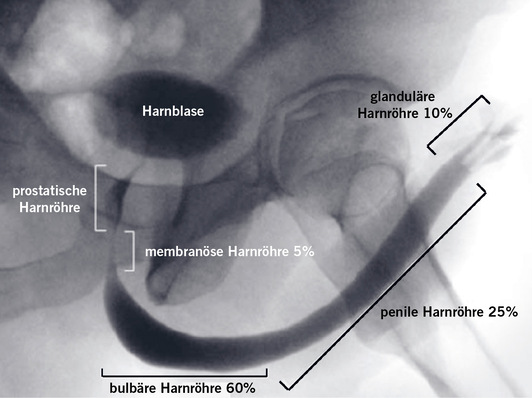Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com
Health wearables & Co. in the company doctor’s office – useful or gimmicky?
Digital health applications such as self-checks, risk scores, and wearables are increasingly being adopted in occupational medicine. This article provides a structured overview of four key areas of application, discusses the potential benefits within the context of occupational health services, and analyzes challenges related to data protection, technology, and user acceptance. Practical recommendations for integration into routine processes and necessary framework conditions complete the article.
Gesundheits-Wearables & Co. in der betriebsärztlichen Sprechstunde – Nützlich oder Spielerei?
Digitale Gesundheitsangebote wie Self-Checks, Scores und Wearables erfahren in der Arbeitsmedizin einen zunehmenden Einsatz. Dieser Artikel gibt einen strukturierten Überblick über vier zentrale Anwendungsbereiche, erörtert Potenziale im betriebsärztlichen Kontext und analysiert Herausforderungen hinsichtlich Datenschutz, Technik und Akzeptanz. Empfehlungen zur Integration in Routineprozesse und erforderliche Rahmenbedingungen runden den Artikel praxisorientiert ab.
Kernaussagen
Einleitung
„Das Internet ist eine Spielerei für Computerfreaks, wir sehen darin keine Zukunft“. An diesem Zitat aus dem Jahr 1990 vom späteren Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, Ron Sommer, wird deutlich, dass sich auch Experten irren können, wenn es um die Frage nach dem Durchsetzungsvermögen von digitalen Technologien geht.
In der heutigen Zeit finden digitale Gesundheitsanwendungen zunehmend Eingang in medizinische Versorgungsprozesse – auch im Setting der betriebsärztlichen Betreuung. In einer zunehmend technologisierten Arbeitswelt stellt sich die Frage, welchen Beitrag digitale Tools zur Förderung von Gesundheit, Prävention und medizinischer Risikoeinschätzung leisten können. Der vorliegende Beitrag beleuchtet praxisnahe Anwendungen wie digitale Selbst-Checks, medizinische Risikoscores, Wearables und deren mögliche Integration in telemedizinische Konzepte – stets unter Berücksichtigung von Chancen, Limitationen und ethisch-rechtlichen Aspekten.
Digitale Selbst-Checks – erste Einschätzung ohne ärztliche Unterstützung
Digitale Selbst-Checks umfassen eine Vielzahl von Anwendungen, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihren Gesundheitszustand eigenständig zu erfassen und zu reflektieren. Dies geschieht meist über Smartphone-Apps oder Webplattformen. Typische Inhalte sind anamnestische Fragebögen zu Symptomen, Vorerkrankungen oder Lebensstilfaktoren. Viele Anwendungen zielen auf die Gesundheitsmotivation ab, beispielsweise durch Empfehlungen zur Bewegungssteigerung oder Ernährungsumstellung.
Ein neuerer Trend sind virtuelle Communities, in denen Nutzende ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig zu gesundheitsfördernden Maßnahmen anregen, zum Beispiel mehr körperliche Aktivitäten in den Alltag einzubauen und Wissenswertes über eine gesunde Ernährung mit anderen zu teilen. Die Durchführung erfolgt in der Regel ohne medizinisch-ärztliche Begleitung.
Beispiele hierfür sind Tools wie BodyCheckOnline oder MyFitnessPal (Fischer 2020), die unter anderem Körperfettanteil, Muskelmasse und metabolisches Alter analysieren. Symptom-Checker wie ADA Health oder WebMD bieten eine auf Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Einordnung von Beschwerden. Studien (Ceney et al. 2012) belegen Trefferquoten zwischen 35 und 70 % – eine diagnostische Orientierungshilfe, die jedoch mit Vorsicht zu interpretieren ist. Besonders auffällig ist die zunehmend hohe Qualität von KI-basierten Chatbots in Bezug auf Medikamenteninformationen, vor allem zu Neben- und Wechselwirkungen, die laut aktuellen Studien (Andrikyan et al. 2025) zu über 95 % zutreffende Antworten liefern.
Digitale medizinische Scores – Unterstützung bei der Risikobewertung
Im Unterschied zu Selbst-Checks erfordern medizinische Scores in der Regel ärztliche Begleitung. Die Eingabe von anamnestischen Daten wird hierbei ergänzt durch Ergebnisse aus apparativer Diagnostik (z. B. Ruhe-EKG) oder Laborparametern (z. B. Blutzucker, Lipide, C-reaktives Protein – CRP). Auf Basis großer Vergleichsdatenbanken und mittels Algorithmen der KI wird das individuelle Risiko für bestimmte Erkrankungen abgeschätzt. Die Analyse und (therapeutische) Handlungsempfehlungen verbleiben dabei bei der Ärztin beziehungsweise dem Arzt.
Ein etabliertes Beispiel ist der Framingham Risk Score, der aus anamnestischen Angaben und Vitalparametern das Risiko für eine koronare Herzkrankheit (KHK) ermittelt. Der ASCVD Risk Calculator der American Heart Association geht noch weiter und berechnet die Wahrscheinlichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses innerhalb der nächsten zehn Jahre. Die Anwendung Cardio Explorer integriert Laborwerte zur KHK-Risikoabschätzung, während das relativ neue Verfahren der Cardisiographie durch KI-gestützte Analyse ein 3D-Vektorelektrokardiogramm erstellt, das aussagekräftiger ist als ein konventionelles Ruhe-EKG. Auch metabolische Risiken beispielsweise für die Entwicklung eines manifesten Diabetes mellitus Typ 2 lassen sich über Tests wie den Diabetes Risk Test der American Diabetes Association validieren (Internetadressen siehe Infokasten).
Die Analyse erfolgt automatisiert, jedoch verbleiben die diagnostische Verantwortung sowie die therapeutische Ableitung klar beim ärztlichen Personal.
Wearables – Gesundheitsdaten in Echtzeit
Wearables sind tragbare Sensorgeräte, die kontinuierlich Vitaldaten erfassen. Hierzu zählen Smartwatches, Fitnessarmbänder, smarte Ringe und implantierbare Sensoren. Erhoben werden unter anderem Herzfrequenz, O2-Sättigung, körperliche Aktivität, Schlafqualität oder Blutzuckerwerte bei diabetologischen CGM-Systemen (kontinuierliche Glukosemessung), die direkt mit einer Insulinpumpe rückgekoppelt werden können (siehe Online-Quellen).
Viele Wearables analysieren die Daten direkt im Gerät und visualisieren sie auf dem Display – dies ermöglicht eine unmittelbare Rückmeldung für Trägerinnen und Träger. Die jüngsten Gerätegenerationen erlauben sogar die Ableitung eines einkanaligen EKGs. Studien wie die Apple Heart Study (siehe Online-Quellen) belegen bei der Erkennung von Vorhofflimmern eine Sensitivität von rund 90 % bei Episoden > 30 Sekunden.
Solche Frühwarnsysteme können bei rechtzeitiger Erkennung von Rhythmusstörungen oder Glukoseentgleisungen relevante Hinweise liefern. Darüber hinaus können Wearables in telemedizinische Konzepte eingebunden werden – etwa durch
automatisierte Datenübermittlung an ärztliche Fachkräfte.
Anbindung an die betriebsärztliche Sprechstunde – Potenziale und Herausforderungen
Eine zentrale Frage für die betriebsärztliche Praxis ist, ob und wie diese digitalen Gesundheitsdaten sinnvoll in die ärztliche Beratung integriert werden können. Hier stellt sich insbesondere die Schnittstellenproblematik: Können Daten aus Wearables oder Apps so aufbereitet werden, dass sie in der (tele-)arbeitsmedizinischen Sprechstunde praktikabel nutzbar sind? Gibt es standardisierte Übertragungswege zur elektronischen Patientenakte (ePA), die aktuell selbst noch in den Kinderschuhen steckt? In hochriskanten Arbeitsumgebungen – etwa auf Bohrinseln – ist die Integration solcher Systeme bereits Realität. Das zeigt, dass es technisch durchaus möglich ist.
Vielleicht liegt eine der wichtigsten Perspektive aber eher darin, nicht so sehr auf „fertige“ Diagnosen zu fokussieren, sondern Mitarbeitende über die Nutzung digitaler Tools stärker in die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit einzubeziehen. Digitale Anwendungen können dabei als Gesprächsanlass in der Sprechstunde fungieren und das Arzt-Patient-Verhältnis stärken.
Limitationen und kritische Aspekte
Trotz des großen Potenzials existieren relevante Limitationen. Zentrale Herausforderungen sind:
Eine Studie von 2020 im Rahmen des Projekts „Prävention für sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Technologien (PräDiTec)“ (siehe Online-Quellen), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, zeigte an über 5000 befragten Beschäftigten in Deutschland, dass auch subjektive Vorbehalte gegenüber digitalen Tools im betrieblichen Kontext bestehen. Insbesondere das Gefühl, zu einer „gläsernen Person“ beziehungsweise einem „gläsernen Patienten“ zu werden, wurde hier kritisch genannt. Es braucht daher eine gezielte, niedrigschwellige Aufklärung und Integration in die betriebliche Gesundheitsförderung.
Fazit
Digitale Gesundheitsanwendungen bieten – bei sinnvoller Auswahl und verantwortungsvoller ärztlicher Begleitung – eine vielversprechende Ergänzung der betriebsärztlichen Versorgung. Sie können die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten stärken, Anlässe für präventive Beratung schaffen und langfristig die Arzt-Patient-Kommunikation verbessern. Gleichwohl sind technische, ethische und organisatorische Aspekte frühzeitig zu berücksichtigen. Die Zukunft der Arbeitsmedizin wird gewiss nicht ausschließlich digital sein – aber ohne digitale Komponenten ist sie kaum mehr denkbar.
Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
Literatur
Andrikyan W, Sametinger SM, Kosfeld F, Jung-Poppe L, Fromm MF, Maas R, Nicolaus HF: Artificial intelligence-powered chatbots in search engines: a cross-sectional study on the quality and risks of drug information for patients. BMJ Qual Saf 2025; 34: 100–109. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2024-017476 (Open Access).
Ceney A, Tolond S, Glowinski A, Marks B, Swift S, Palser T: Accuracy of online symptom checkers and the potential impact on service utilisation. PlosOne 2012 (15). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254088 (Open Access).
Fischer F: Digitale Interventionen in Prävention und Gesundheitsförderung: Welche Form der Evidenz haben wir und welche wird benötigt?. Bundesgesundheitsbl 63, 674–680 (2020). https://doi.org/10.1007/s00103-020-03143-6 (Open Access).
Goff DC Jr, Lloyd‑Jones DM, Bennett G et al.: 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2014; 63: 2935–2959. doi:10.1161/01.cir.0000437741.48606.98 (Open Access).
Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H et al.: Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation. N Engl J Med 2019: 381: 1909–1917. doi:10.1056/NEJMoa1901183 (Open Access).
Wilson PWF, D’Agostino RB, Levy D et al.: Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998; 97: 1837–1847. doi:10.1161/01.cir.97.18.1837 (Open Access).
Online Quellen
ADA – American Diabetes Association: Diabetes Risk Test. 2021
https://diabetes.org/diabetes-risk-test
Climedo: Medizinische Wearables in klinischen Studien: Herausforderungen und Chancen
https://climedo.de/blog/medizinische-wearables-in-klinischen-studien-he…
Stanford Medicine: Apple Heart Study
https://www.cnet.com/tech/mobile/apple-and-stanford-release-apple-watch…
PräDiTec – „Prävention für sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Technologien“ der Universität Augsburg 2020; gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
https://www.fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/1416/wi-1416.pdf
Info
Framingham Risk Score www.framinghamheartstudy.org
ASCVD Risk Calculator www.mdcale.com
Cardio Explorer www.explorishealth.com
Cardisiographie www.cardis.io
Diabetes Risk Test www.diabetes.org