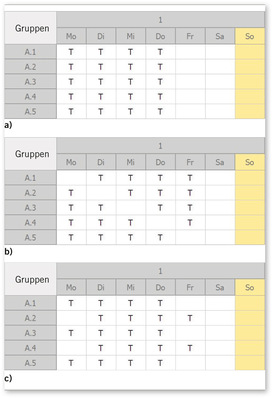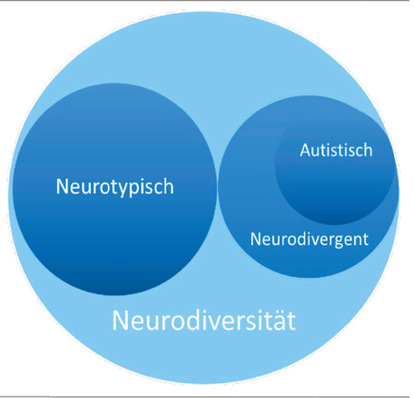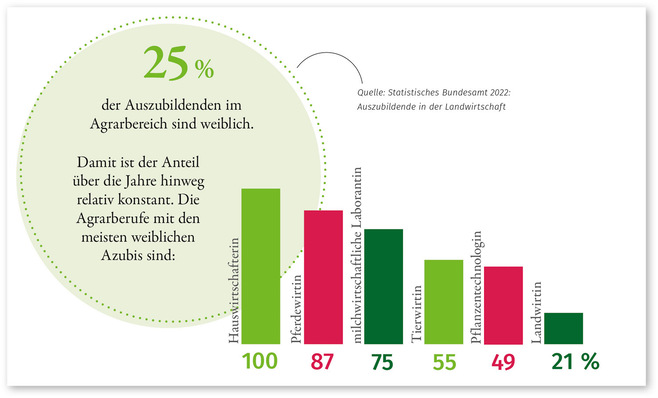Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
Die MAK-Kommission ist ein unverzichtbarer Pfeiler des Arbeitsschutzes. Ihre wissenschaftlich fundierten Empfehlungen und Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Stoffe sind die Grundlage für Präventionsmaßnahmen und Schutzvorschriften in zahlreichen Branchen. Dies ist das Ergebnis der engagierten Arbeit von Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen – von der Toxikologie über die Arbeitsmedizin und Chemie bis hin zur Pathologie und Messtechnik.
In unserer Serie „70 Jahre MAK-Kommission“ werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben die verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission vorstellen. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erfahren Sie, wie die MAK-Kommission auch heute noch eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Arbeitswelt von morgen sicherer und gesünder zu gestalten.
In der dritten Folge der Interview-Reihe berichtet Prof. Dr. Thomas Göen, Leiter der Arbeitsgruppe „Biomonitoring“ der MAK-Kommission, von den Aufgaben und der Bedeutung des Biomonitorings bei der Risikobewertung am Arbeitsplatz.
70 Years of the MAK Commission: Paving the way for healthy workplaces (Part 3): Reliable analysis methods for reliable risk assessment
The German Research Foundation’s Commission on Occupational Chemical Substances (MAK Commission) not only handles the classification of occupational substances and the derivation of assessment values. Through its Biomonitoring Working Group, it also ensures the availability of recognized and reliable analytical methods so that biomonitoring, as defined by ArbMedVV, can be used without restriction to determine health risks to employees. The methods used by the Biomonitoring Working Group are based on both high scientific standards and the necessity and suitability for practical occupational health care.
70 Jahre MAK-Kommission: Wegbereiter für gesunde Arbeitsplätze (Teil 3): Zuverlässige Analysenverfahren für eine zuverlässige Risikoerfassung
Die Arbeitsstoffkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission) kümmert sich nicht nur um die Einstufung von Arbeitsstoffen und die Ableitung von Beurteilungswerten. Mit der Arbeitsgruppe Biomonitoring sorgt sie auch für die Verfügbarkeit anerkannter und zuverlässiger Analysenmethoden, damit ein Biomonitoring im Sinne der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) für die Feststellung der gesundheitlichen Gefährdung von Beschäftigten uneingeschränkt genutzt werden kann. Die Methoden der AG Biomonitoring orientieren sich dabei sowohl an hohen wissenschaftlichen Standards als auch an der Notwendigkeit und Tauglichkeit für die arbeitsmedizinische Praxis.
Herr Professor Göen, die AG Biomonitoring ist eine zentrale Arbeitsgruppe innerhalb der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. Welche spezifische Aufgabe erfüllt Ihre Arbeitsgruppe im Vergleich zu anderen AGs, und wie trägt ihre Arbeit zur ganzheitlichen Risikobewertung von Arbeitsstoffen bei?
T. Göen: Besten Dank für das Stichwort Risikobewertung. Es verdeutlicht nämlich, dass es bei der Arbeit der Kommission nicht nur auf die Identifizierung von Gefährdungsmerkmalen eines Stoffes ankommt, sondern die Beurteilung der toxischen Dosis im Vordergrund steht. Das heißt, dass auch Einstufungen der Kommission, wie zum Beispiel Schwangerschaftsgruppe oder die Hautresorptionskennzeichnung, in Bezug zu den von ihr erarbeiteten Grenzwerten und Beurteilungswerten erfolgen.
Aufgrund dieser herausragenden Bedeutung der Grenzwerte und damit der Quantität eines Stoffes, hat sich die Arbeitsstoffkommission schon sehr früh dazu entschlossen, auch geeignete Werkzeuge für eine zuverlässige Überwachung der Grenzwerte zur Verfügung stellen zu wollen. Deshalb wurden vor über 50 Jahren die beiden analytischen Arbeitsgruppen gegründet. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe „Analysen in biologischem Material“ ist es, Methoden zur Quantifizierung sowohl von biologischen Belastungsmarkern, das heißt Konzentrationen von Gefahrstoffe und Metaboliten in Urin und Blut, aber auch von biologischen Effektmarkern, wie beispielsweise der Aktivität der Neurotoxischen Esterase („neuropathy target esterase“, NTE) in Lymphozyten oder der renalen Ausscheidung der Delta-Aminolävulinsäure als Parameter der Hämsynthese-Störung, zu entwickeln, ihre Zuverlässigkeit und Praktikabilität zu verifizieren und nach intensiver Diskussion und Bestätigung im Expertengremium zu publizieren. Dabei stimmt sich die AG Biomonitoring eng mit der Arbeitsgruppe Beurteilungswerte in biologischem Material ab, damit für alle Parameter, für die die Kommission Beurteilungswerte festlegt, auch die entsprechenden Methoden verfügbar sind.
Das Biomonitoring hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Können Sie uns kurz die grundlegenden Prinzipien des Biomonitorings erläutern und aufzeigen, welche entscheidenden Fortschritte Ihre Arbeitsgruppe in diesem Bereich erzielt hat, die für die arbeitsmedizinische Praxis von großer Bedeutung sind?
T. Göen: Die innere Belastung von Beschäftigen mit Gefahrstoffen, die mit dem Biomonitoring quantifiziert und beurteilt wird, ist ein Resultat sowohl aus allen potenziellen Resorptionspfaden (vornehmlich inhalativ und perkutan, aber auch u. U. oral) als auch der tatsächlichen Präventionssituation (Verhältnis- und Verhaltensprävention). Damit ist das Biomonitoring die einzige Messstrategie, die eine zuverlässige Erfassung der individuellen Exposition und damit die gesundheitliche Gefährdung der Beschäftigten beim Umgang mit Gefahrstoffen gewährleistet. Folglich hat der Vorordnungsgeber das Biomonitoring auch als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge hervorgehoben. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass kein anderes Gremium – weder in Deutschland noch in der EU oder sonst weltweit – geprüfte Analysenverfahren für das Biomonitoring zur Verfügung stellt. Somit ist die Arbeit der Arbeitsgruppe Analysen in biologischem Material essenziell, damit Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner das Biomonitoring wie in der ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge) vorgeschrieben auch sinnvoll nutzen kann. Neben den Analysenmethoden entwickelt die Arbeitsgruppe auch grundlegende Konzepte, die sowohl für die Qualitätssicherung als auch für die Weiterentwicklung des Biomonitorings von Bedeutung sind. Dabei wird der wissenschaftliche Stand zu einzelnen Analysentechniken, wie zum Beispiel die Dampfraum-Probenahme für die Bestimmung leichtflüchtiger Parameter, das Potenzial und die Bedingungen neuer besonders leistungsfähiger Parameter, wie die Bestimmung von Hämoglobin-Addukten oder Metallspezies im humanbiologischem Material, oder auch alternative humanbiologische Materialien, beispielsweise Speichel, ausgewertet und Stellungnahmen dazu abgeleitet. Dass diese konzeptionellen Arbeiten nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in Englisch publiziert werden, gewährleistet den notwendigen Austausch mit der internationalen Fachwelt, so dass wichtige Weiterentwicklungen und Innovationen nicht verloren gehen.
Die Entwicklung und Validierung neuer Biomonitoring-Methoden ist komplex. Welche methodischen Herausforderungen stellen sich Ihrer Arbeitsgruppe bei der Etablierung zuverlässiger und praktikabler Analyseverfahren für die Überwachung von Arbeitsstoffexpositionen, insbesondere bei neuen oder schwer nachweisbaren Substanzen?
T. Göen: Grundsätzlich ist zu bedenken, dass beim Biomonitoring oft nicht der Gefahrstoff selbst, sondern ein Metabolit oder Reaktionsprodukt des Stoffes bestimmt werden muss. Somit stellt sich häufig die Frage, ob eine Referenzsubstanz, die für die Kalibrierung eines analytischen Verfahrens benötigt wird, für den Parameter überhaupt kommerziell verfügbar ist oder auch noch die chemische Synthese des Analyten eingeplant werden muss. Außerdem weisen die gängigen humanbiologischen Materialen, also Blut, Blutkompartimente und Urin, in der Regel deutliche Matrix-bezogene Einflüsse auf, so dass zum einen eine Kalibrierung in der Realmatrix und darüber hinaus eine interne Korrektur über strukturidentische Isotopen-markierte Verbindungen für eine zuverlässige Analytik benötigt werden.
Ein großer Vorteil des Biomonitorings ist die Erfassung der tatsächlichen inneren Belastung des Menschen durch Arbeitsstoffe, unabhängig vom Aufnahmeweg. Inwieweit hilft dies, die Gesamtbelastung von Beschäftigten zu bewerten, die auch Expositionen außerhalb des Arbeitsplatzes umfassen kann, und welche Rolle spielt die AG Biomonitoring bei der Abgrenzung beruflicher von nicht-beruflicher Exposition?
T. Göen: Für die Beurteilung des Gesundheitsrisikos spielt es im Grunde keine Rolle, ob der Gefahrstoff am Arbeitsplatz oder aus der Umwelt aufgenommen wird. Wenn man die Daten allerdings nicht nur für die medizinische Vorsorge, sondern auch für die Beurteilung der Arbeitsplatzbedingungen nutzen möchte, ist eine Abgrenzung dann durchaus von Interesse. Diese Abgrenzung zwischen beruflichen und außerberuflichen Belastungen lässt sich beim Biomonitoring durch unterschiedliche Strategien erreichen. Zum einen wird von der Arbeitsgruppe Beurteilungswerte in biologischem Material für viele Parameter der sogenannte Biologische Arbeitsstoff-Referenzwert (BAR) abgeleitet, der den oberen Konzentrationsbereich
(95. Perzentil) der allgemeinen Hintergrundbelastung von Personen im erwerbsfähigen Alter beschreibt. Ein Vergleich der Biomonitoringergebnisse mit dem BAR lässt in der Regel somit erkennen, ob eine berufliche Zusatzbelastung vorliegt. Eine weitere Strategie liegt darin, die chemische Form der Belastung weiter zu spezifizieren. Ein gutes Bespiel hierfür ist die Differenzierung von Arsenspezies. Dabei kann zwischen den am Arbeitsplatz auftretenden anorganischen Arsenverbindungen und deren Metaboliten auf der einen Seite und dem ausschließlich aus Fischkonsum resultierenden organischen Arsenobetain auf der anderen Seite unterschieden werden. Die Differenzierung ist auch mit Blick auf die Beurteilung des Gesundheitsrisikos von Bedeutung, da das Arsenobetain im menschlichen Körper nicht zu den toxischen Arsenspezies umgewandelt werden kann.
Welche neuen Trends oder technologischen Entwicklungen sehen Sie im Bereich des Biomonitorings, die das Potenzial haben, die arbeitsmedizinische Überwachung in den kommenden Jahren maßgeblich zu verändern? Denken Sie dabei an neue Biomarker, Analyseverfahren oder auch die Integration von Daten aus dem Biomonitoring in digitale Gesundheitssysteme?
T. Göen: Ein hehres Ziel ist beim Biomonitoring die Erfassung der ultimativ toxischen Verbindung, häufig ein reaktionsfreudiger Metabolit des Gefahrstoffes. Dies impliziert zunächst die Voraussetzung, dass die relevante chemische Struktur im Rahmen mechanistisch-toxikologischer Untersuchungen hinreichend identifiziert werden konnte. Für die Analytik ergeben sich dann aber häufig Herausforderungen, weil die toxische Struktur nur in sehr geringen Konzentrationen auftritt und aufgrund ihrer Reaktivität eine spezifische Probenaufbereitung erfordert. Derartige Herausforderungen müssen bei der Entwicklung neuer Analysenmethoden häufiger mitgedacht werden.
Eine weitere Strategie, die in der Arbeitsgruppe zukünftig verstärkt umgesetzt werden soll, ist die Entwicklung von Analysemethoden, die ein breites Spektrum von Parametern einer Stoffgruppe umfassen. Dieser Ansatz ist nicht nur ökonomisch und zur Schonung der materiellen, energetischen und vor allem personellen Ressourcen sinnvoll, sondern mit Blick auf die Erfahrungen aus der Praxis angezeigt. In zunehmenden Maße ist an den Arbeitsplätzen zwar die eingesetzte Produktgruppe, aber häufig nicht der konkret vorliegende chemische Arbeitsstoff bekannt. Dies gilt vornehmlich für Additive und Hilfsstoffe, wie zum Beispiel per- und polyfluorierte Benetzungsmittel, Weichmacher für Kunst- und Beschichtungsstoffe oder Vernetzungsmittel und Härter, aber insbesondere für Gefahrstoffe, die am Arbeitsplatz erst entstehen, wie beispielsweise polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Die Verfügbarkeit von Multikomponentenmethoden ist zur Klärung solcher Fragestellungen essenziell.
Mit Blick auf die Integration des Biomonitorings in digitale Systeme ist festzustellen, dass sich die quantitativen Daten, die beim Biomonitoring gewonnen werden, perfekt für eine digitale Verarbeitung und Nutzung eignen. Dies gilt im besonderen Maße für die statistische Weiterverarbeitung, die ja zwingend notwendig ist, damit Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner entsprechend ArbMedVV auf Indizien eines möglicherweise unzureichenden Arbeitsschutzes prüfen können.
Wünschenswert für die Zukunft wäre natürlich auch eine weitergehende Auswertung, in der die Biomonitoringergebnisse mit parallel erhobenen Daten zur äußeren Belastung, zum Beispiel Luftbelastung oder Hautbelastung, verglichen werden. Die Ergebnisse solcher Auswertungen – und hier schließt sich wieder der Kreis – würde die Kommission natürlich sehr gerne nutzen, denn grundsätzlich haben Erfahrungen am Menschen aus Sicht der Kommission eine deutlich höhere Wertigkeit als Daten aus Tierversuchen, In-vitro-Testungen oder Modellrechnungen.
Vielen Dank, Herr Professor Göen, für das aufschlussreiche Gespräch!
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Göen
Leiter der DFG-Arbeitsgruppe „Analysen in biologischem Material“