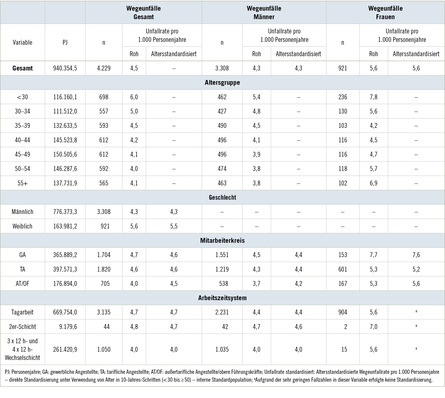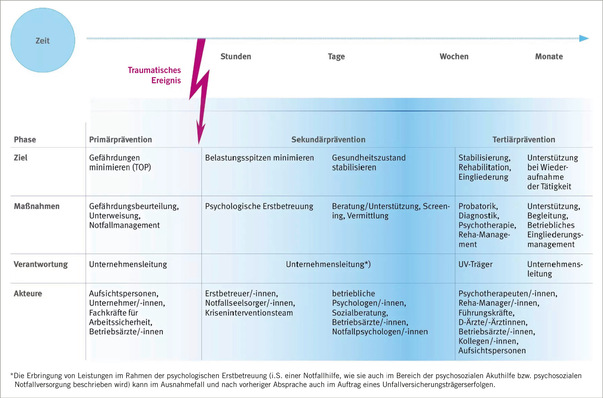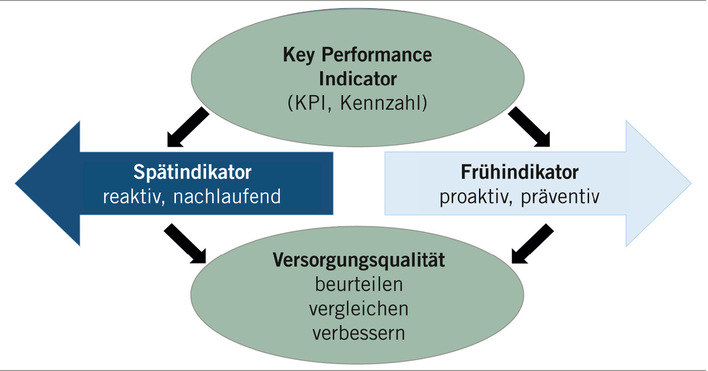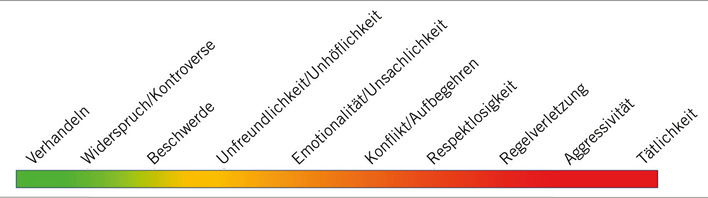EinleitungRechtliche Grundlage: Betriebliche Suchtprävention
Die Ursprünge und die heutige Stellung der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe basiert auf den in den 40er Jahren in den USA entwickelten arbeitsplatzbezogenen Alkoholprogrammen, auf die sich auch aktuelle Konzepte zurückführen lassen.
In Deutschland gibt es ebenso eine lange Tradition der Suchtprävention im Betrieb (Wendt-Danigel u. Heegner 2012; Demann 2013; Freigang-Bauer u. Gusia 2013). Dies geschieht nach dem Grundsatz, dass der Arbeitgeber den Beschäftigten vor Schädigungen durch die Arbeit zu schützen hat. Für diese Aufgaben hat der Arbeitgeber nach Maßgabe des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) von 1973 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. 1996 folgte das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“, das zuletzt durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 geändert worden ist.
Der Arbeitgeber hat nach § 5 ArbSchG „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch: die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, (…) die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, (…) psychische Belastungen bei der Arbeit.
Das ArbschG hat bereits 1996 den Schutz der Beschäftigten vor physischen zwar auch den psychischen Belastungen vorgesehen, aber nicht explizit festgeschrieben. Spätestens mit der Klarstellung im ArbSchG von 2015, dass der Beschäftigte auch bei psychischen Belastungen Arbeitsschutzgesetz geschützt werden muss, ist der gesetzliche Auftrag zur betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe als ein integraler Bestandteil der Vorbeugung und Abwendung arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen noch deutlicher geworden.
Zahlreiche Suchtpräventionsprogramme sind über die Betriebs- oder Dienstvereinbarung und die Regelung zur Unfallverhütung hinaus in Laufe der Jahre geschaffen worden ( Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2011; s. „Weitere Infos“). So führen die Landesärztekammer seit Jahrzehnten Programme für Ärztinnen und Ärzte mit Suchtproblematik in Koooperation mit den Oberbergkliniken mit großem Erfolg durch (Freigang-Bauer u. Gusia 2013; Schoeller 2014)
Suchtproblem nicht nur Privatsache
Konsum von Suchtmittel wie Alkohol, Drogen oder Medikamenten bleibt bekanntlich nicht vor den Türen von Arbeitgebern, Unternehmen oder Behörden außen vor. Mit der Erweiterung des Arbeitsschutzes sind somit Suchtprobleme am Arbeitsplatz nicht allein Privatsache des Beschäftigten, Kollegen oder Vorgesetzten. Suchtmittelkonsum hat bekanntlich negative Auswirkungen in allen Lebensbereichen, also auch auf den Arbeitsplatz. Mittlerweile befassen sich eine Vielzahl von Beschäftigten in Unternehmen, Betrieben oder Firmen, haupt-, nebenberuflich oder ehrenamtlich tätige Suchthelfer sowie auch Führungskräfte, Personalverantwortliche mit der Thematik „Suchtmittel im Arbeitsleben“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2015; s. „Weitere Infos“)
Im Jahr 2015 widmete sich das 11. Berliner Suchtgespräch dem Thema „Suchthilfe in der kulturellen Vielfalt“. In Deutschland lebten im Jahr 2014 etwa 16 Millionen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, was rund 20 % der Gesamtbevölkerung entspricht (s. „Weitere Infos“). Diese Tatsache wirkt sich sowohl auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft als auch auf die betriebliche Suchtprävention aus. Die hohe Relevanz für alle aktiv Beteiligten in der betrieblichen Suchtprävention ergibt sich aus verschiedenen Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte stärker von Sucht, Unfällen und anderen Gesundheitsproblemen betroffen sind, als die Allgemeinbevölkerung (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2011).
Suchtmittelkonsum vor dem kulturellen Hintergrund
In den fünfziger Jahren kamen die ersten Zuwanderer, „Arbeitsmigranten“, als sog. „Gastarbeiter“ aus Italien, Spanien, dem damaligen Jugoslawien und Griechenland, den sog. „Anwerbestaaten“, nach Deutschland. Weitere Migrationswellen folgten in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren. Die meisten Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte waren ungelernte Arbeiter und kamen als Hilfskräfte für die Industrie. In den 1990er Jahren kamen aus Russland sowie aktuell aus dem Irak, Afghanistan und Syrien viele Menschen nach Deutschland (11. Berliner Suchtgespräch 2015; s. „Weitere Infos“).
Heute stellen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte mit 2,5 Millionen die mehrheitlich muslimischen Zuwanderer aus der Türkei und ihre Nachkommen die größte Einwanderungsgruppe in Deutschland dar. Gemeinsam mit den muslimischen Migrantinnen und Migranten aus den arabischen Ländern, aus dem Iran, Balkan, Afrika etc. sind Muslime mit ca. 3,5 Millionen Menschen mit Abstand die größte Zuwanderungsgruppe in Deutschland (Kimil u. Salmann 2010).
Für die erste Generation der Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte war „Sucht“ kein großes Thema. Gelegentlich gab es bei Männern Probleme durch Alkohol und Nikotin. Bei Menschen mit einer muslimischen Zuwanderungsgeschichte wird davon ausgegangen, dass die Religion einen protektiven Faktor darstellt. Gleichwohl kommt Alkoholabhängigkeit auch hier häufiger vor als weitläufig angenommen ( Religionswissenschaftlicher Medien- u. Informationsdienst 2009). Betroffene verschweigen ihre Alkoholprobleme aus Scham und Angst vor Gesichtsverlust. Vielfach werden Heilungsversuche (z. B. Entgiftungen)in den Heimatländern unternommen (Ögel 1997). Bei Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte aus dem slawischen Kulturraum Ost- und Südosteuropa stellt Alkoholkonsum ein noch viel größeres Problem dar. Nikotinkonsum wird dagegen vor allem bei männlichen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte im Alltag häufig nicht als Suchtverhalten verstanden.
Eine erheblich unterschätzte Suchtform bei Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte stellt die Spielsucht dar. Viele Männer der ersten und zweiten Generation aus Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte aus der Türkei sowie Menschen mit arabischem Emigrationshintergrund verbringen einen Großteil ihrer Freizeit in sog. Männer-Cafés, wo Kartenspiele oder Spielautomaten zum Alltag gehören.
Frauen mit einer Zuwanderungsgeschichte weisen aufgrund von vielfachen Mehrfachbelastungen, wie Fabrikarbeit bei gleichzeitiger Kindererziehung sowie Haus- und Familienarbeit, einen vermehrten und unreflektierten Konsum von Medikamenten (Schmerzmittel, Antidepressiva, Beruhigungsmittel etc.) auf ( Kimil u. Salmann 2010).
Sowohl der Medikamentenmissbrauch, der laut verschiedener Studien häufiger bei Frauen auftritt, als auch die Spielsucht bei den überwiegend männlichen Beschäftigten mit einer Zuwanderungsgeschichte werden in Betrieben und im betrieblichen Umfeld seltener sichtbar und deshalb nicht als betriebliches Problem erkannt. Bisher liegen keine ausreichend verlässlichen Daten und Studien zur Medikamentensucht und Spielsucht bei Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte vor (Kimil u. Salmann 2010).
Bei den Kindern der zweiten und dritten Generation der Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte neigen die besser integrierten jungen Menschen eher zum Konsum von Cannabis, während die vulnerablen und schlechter integrierten eher Heroin, Kokain oder Amphetamine konsumieren (Kimil u. Salmann 2010).
Epidemiologische Untersuchungen zeigen auf, dass Suchtprobleme, vor allem von Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, zu den häufigsten psychosozialen Problemfeldern dieser Zielgruppe gehören (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2011).
Ende der Neunzigerjahre wurde die Zahl der Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die von Alkohol, Medikamenten oder illegalen Drogen abhängig waren, auf 300.000 bis 400.000 Personen geschätzt (Hüllingerhorst u. Holz 1998; Czycholl 1998) worden.
Migration, Akkulturation und Stress
Die Migrationsforschung berichtet unabhängig voneinander, dass beim Migrationsprozess und der damit einhergehenden sozialen Akkulturation und psychischen Adaption an die neue Kultur Stressphänomene auftreten können. Neben physischen (etwa klimatischen Veränderungen, anderen Ess- und Kleidungsgewohnheiten, Verlassen der gewohnten Umgebung) und kulturellen Veränderungen (Akkulturation von einer kollektivistischen in eine individualistische Gesellschaft etc.) stellen tiefgreifende psychosoziale Veränderungen eine wesentliche Dimension der Migrationsforschung dar. Besonders Brüche und Trennungen in sozialen Beziehungen und Netzwerken, die bis dahin Lebensinhalt und -sinn vermittelt haben, wirken sich auf das psychische Wohlbefinden aus (Han 2005).
Stresspsychologisch reflektiert stellen diese angedeuteten Veränderungen kritische Lebensereignisse, sog. „life events“ (Lazarus u. Launier 1981) und stressauslösende Anforderungen aus der inneren und äußeren Umwelt dar, die das biopsychosoziale Gleichgewicht massiv stören und das Wohlbefinden dysfunktional beeinflussen können. Nach C. Sluzki kann der psychosoziale Anpassungsprozess an die Kultur im Zuge der Migration über mehre Generationen andauern (Sluzki 2010).
Untersuchungen belegen auch, dass Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte häufiger nicht oder schlechter über die Hilfs- und Unterstützungsangebote bei Suchtproblemen informiert sind. Sie werden kaum von präventiven Angeboten erreicht. Unterschiedliche Zugangsbarrieren zu den Hilfsangeboten haben Einfluss auf die gesundheitlichen Risiken aufgrund von Abhängigkeitserkrankungen.
Gegenwärtige Herausforderungen für die betriebliche Suchtprävention
In der Reflektion der individuellen Suchtbiografie von Herrn A. zeigen sich deutlich die folgenden Zugangsbarrieren:
- Fehlen von bundesweiten Daten zur Inanspruchnahme von Suchthilfeeinrichtungen,
- Kommunikationsbarrieren sprachlich und kulturell,
- unzureichendes Wissen über Drogen und Abhängigkeit,
- geringe Kenntnisse von Hilfsangeboten,
- Assoziation von Beratung mit Schwäche,
- schlechte Erfahrungen mit Ämtern/Behörden werden auf das Suchthilfesystem übertragen,
- Angst vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen.
Interkulturalität in betrieblichen Suchtprävention
Somit wirft sich die Fragestellung auf: Was könnten Grundlagen eines interkulturellen betrieblichen suchtpräventiven Ansatzes sein?
Allgemein formuliert sollten dies im interkulturellen betrieblichen suchtpräventiven Kontext sein:
- Interesse und Wertschätzung als Basis,
- Beachtung der jeweiligen Biografie,
- Kenntnis der eigenen kulturellen Identität,
- Arbeit mit Kulturvermittlern, die ggf. auch qualifiziert dolmetschen,
- Krankheitsverständnis des Betroffenen beachten,
- Beachten von individuellen Erklärungsmodellen und Ausarbeiten kulturell passender Erklärungen und Angebotsmaßnahmen.
Durch den strukturellen Wandel in der Gesellschaft ergeben sich in der Arbeitswelt Veränderungen. Als spezifische Zielgruppe sollten die Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte durch die betriebliche Suchtprävention aktiv angesprochen werden. Im Zuge der demografischen Entwicklung und Veränderung der Sozialsysteme blieben somit Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte länger im aktiven Berufsleben (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2011).
Interessenkonflikt. Die Autorinnen erklären, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.
Literatur
Czycholl D: Sucht und Migration. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1998.
Demann J: Betriebliche Suchtprävention: Königsdisziplin des Betriebsarztes. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2013; 48: 449–451.
Freigang-Bauer I, Gusia G: Betriebliche Suchtprävention in Klein- und Kleinstbetrieben, ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2013; 10: 577–580.
Han P: Soziologie der Migration. Erklärungsmodelle, Fakten, politische Konsequenzen, Perspektiven. München: Lucius & Lucius, 2005.
Hüllinghorst R, Holz A, Salman R: Kultursensible Prävention: Migration und interkulturelle Koomunikation der Suchthilfe. Konturen – Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen 2010; 5: 8–14.
Kimil A, Salman R: Migration und Sucht. In: Hegemann T, Salman R (Hrsg.): Handbuch Transkulturelle Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2010, S. 368.
Lazarus RS, Launier R: Streßbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In: Nitsch JR (Hrsg.): Stress: Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen. Bern: Huber, 1981, S. 213–259.
Ögel K: Hollanda ve Belçika’da yasayan türkler arasinda madde kullanm. AMATEM: Istanbul, 1997.
Schoeller A: Ärztegesundheit – Ein Thema? ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2014; 49: 107–110.
Sluzki C: Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In: Hegemann T, Salman R (Hrsg.): Handbuch Transkulturelle Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2010, S. 108–123.
Wendt-Danigel C, Heegner S: Voraussetzung für eine erfolgreiche betriebliche Suchtarbeit und Suchtprävention. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed (Praxis) 2012; 10: 137–139.
Handlungsempfehlungen
Für die betriebliche Suchtprävention lassen sich folgende trans- und interkulturelle Handlungsempfehlungen ableiten:
- Datenerhebungen in der betrieblichen Suchtprävention sollten zukünftig in differenzierter Form Migrationshintergründe evaluieren.
- Trans- und interkulturelle Aspekte sollten in der betriebsärztlichen Praxis, Forschung und Evaluation regelhaft Berücksichtigung finden.
- Alle Akteure in der betrieblichen Suchtprävention sollten über ein Grundverständnis von kultureller Vielfalt und Migrationsprozessen verfügen.
- Interkulturelle Kompetenz der Akteure sollte durch regelmäßige interkulturelle Weiterbildung vertieft werden.
- Einbindung von Suchtprävention unter emigrationsspezifischen Aspekten in das betriebliche Gesundheits- oder Qualitätsmanagement und Vernetzung der Träger der Suchtprävention mit diesen betrieblichen und überbetrieblichen Akteuren.
- Entwicklung von praxisgerechten und einfach zugänglichen Informations- und Handlungshilfen zur individuellen und betrieblichen Suchtprävention für Zielgruppen, (Sicherheits-)Beauftragte und Fachkräfte.
- Entwicklung von überbetrieblichen, kooperativen Informations-, Ausbildungs- und Transferstrategien
- Diskussion von an Strukturen ansetzenden Suchtpräventionskonzepten und Auslotung der Potenziale von institutionenübergreifenden Netzwerken
- Stärkung der öffentlichen und betrieblichen Aufmerksamkeit durch Fokussierung des Informationsangebots zur betrieblichen Suchtprävention, gezielte Nutzung vorhandener fachlicher Ressourcen zur Suchtprävention.
- Strategische Präventionsansätze, bei denen auch die Reflexion von Gender Mainstreaming Berücksichtigung findet.
Praxisbeispiel
Herr A. wurde in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet geboren. Seine Eltern kamen gebürtig aus Afghanistan. Der Vater studierte Wirtschaftswissenschaft an einer Deutschen Universität. Nach Abschluss des Studiums des Vaters sei die Familie zurück nach Afghanistan gezogen. Herr A. hatte gerade die Grundschule beendet. Der Vater sei in Afghanistan in der Wirtschaftspolitik tätig geworden. Herr A. habe in Afghanistan eine deutsche Schule besucht. Er absolvierte sein Abitur und ein Studium in Wirtschaft. Aufgrund politischer Unruhen und des Regimewechsels habe die Familie aus Afghanistan fliehen müssen. Sie seien über Pakistan nach Deutschland geflohen. In Pakistan habe er mit seiner Familie ein Jahr im Untergrund leben müssen. Das sei eine sehr beängstigende und belastende Zeit gewesen. Mit 19 Jahren sei er wieder mit seiner Familie in Deutschland angekommen.
Die folgenden fünf Jahre seien eine schwere existenzbedrohende Zeit gewesen. Seine Abschlüsse und sein Studium seien ihm nicht anerkannt worden. Eine Arbeitserlaubnis bestand nur unter der Vorgabe, dass kein deutscher Bürger oder sog. EU-Bürger die angebotene Tätigkeit ausüben konnte. Zudem habe über fünf Jahre ein vakanter Aufenthaltsstatus bestanden. Gleichwohl habe Herr A. mit jeglichen Jobs versucht, sich zu finanzieren. Während dieser Zeit habe er begonnen, übermäßig viel Alkohol zu konsumieren. Er habe versucht, sich anzupassen, wollte modern und offen sein. Auch habe der Alkoholkonsum zur Linderung seiner Sorgen und Ängste beigetragen.
Herr A. absolvierte sein Abitur und Studium in Wirtschaft in Deutschland. Im Anschluss begann er eine berufliche Laufbahn bei einem Flugzeugunternehmen. Dort arbeitet er in anspruchsvollen Bereichen sowie als Projektleiter. Herr A. hatte geheiratet und drei Kinder mit seiner Frau. Der Alkoholkonsum reduzierte sich leicht, verlagerte sich jedoch auf die Wochenenden. Die Familie pflege die Tradition, sich über den Globus verteilt regelmäßig zu treffen. Auf diesen Treffen werde öffentlich kein Alkohol konsumiert. Die Männer träfen sich an ihren Autos. Im Kofferraum wäre eine Bar mit Alkohol. Tradition sei, den Partyraum zu verlassen und draußen in einer Gruppe mit Männern zu trinken. Eine andere Gruppe, die jüngeren Männer, konsumierten in einer anderen Ecke Cannabis. Herr A. habe über ca. 12 Jahre diese Gewohnheit, Alkohol zu trinken, gepflegt. Vor ca. 1½ Jahren habe er seinen Führerschein verloren. Er sei nach einem Streit mit seiner Frau eine kurze Strecke selbst mit seinem Auto gefahren. Ein Restalkohol von 2,02 Promille sei gemessen worden.
Vorstellig in der Suchtberatungsstelle wurde Herr A., da er von der MPU-Begutachtungsstelle eine Empfehlung erhalten hatte. Im Beratungsprozess wurde deutlich, dass Herr A. keinerlei Kenntnis über die Suchtgefahr des Alkoholkonsums hatte. Die Verhaltensgewohnheiten vollzogen sich automatisiert im kulturellen Kontext. Während der Aufarbeitung seiner Konsumgeschichte wurde deutlich, dass Herr A. unter emigrationsspezifischen Stress sowie einer kulturell bedingten dysfunktionalen Gewohnheit Alkohol missbräuchlich bis riskant konsumiert hatte. Sich an die betriebliche Suchtprävention zu wenden, war mit großer Sorge, Angst und Scham vor Statusverlust verbunden. Herr A. gab an, dass alle Kollegen und Vorgesetzen davon ausgingen, da er Muslim sei, würde er keinen Alkohol trinken. Auch habe er in seinem privaten sozialen Kreis nicht über negative Folgen des Alkoholkonsums sprechen können. Es wäre ihm als Schwäche ausgelegt worden. Der Hausarzt habe ein Diabetes Typ 2, Bluthochdruck sowie Magen- und Darmprobleme diagnostiziert. Ein Rückschluss auf übermäßigen Alkoholkonsum habe nicht stattgefunden. Kenntnisse über das Suchthilfesystem mit seinen vielfältigen Angeboten und der betrieblichen Suchtprävention bestanden nicht.
Weitere Infos
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS): Qualitätsstandards in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe, 2011
www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Arbeitsfeld_Arbeitsplatz/Qualitaetsstandards_DHS_2011.pdf
Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren (DHS): Suchtprobleme am Arbeitsplatz, 2015
www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtprobleme_am_Arbeitsplatz.pdf
Dokumentation des 11. Berliner Suchtgesprächs „Suchthilfe in der kulturelleren Vielfalt“, 2015
www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Service/Publikationen/Partnerschaftlich/2016/PS_01-16.pdf
Für die Autorinnen
Melanie Berg
Dipl. Sozialarbeiterin
Sucht- und Sozialtherapeutin (VDR – anerkannt)
Supervisorin (DGSv. Zertifiziert)